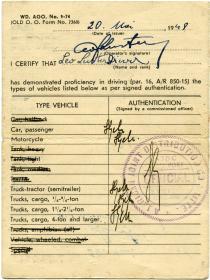Leo Luster
Stadt: Givatayim
Land: Israel
Datum des Interviews: August 2010
Name der Interviewerin: Tanja Eckstein
Das erste Mal begegnete ich Leo Luster in Wien im Cafe Schottenring. Dort trafen sich einmal im Monat die ehemaligen Hakoah-Spieler. Leo und sein Sohn Moshe waren anlässlich eines Filmvorhabens über Aron Menczer in Wien.
Aron Menczer war ein junger Mann, der vielen jüdischen Kindern in Wien und im Ghetto Theresienstadt das Leben in einer unerträglichen Zeit erträglich gemacht hat und vielen von ihnen das Leben retten konnte.
Er selber wurde 1943 zusammen mit 1.260 aus Bialystok ins Ghetto Theresienstadt gebrachten Kindern von Theresienstadt nach Auschwitz deportiert und ermordet. Zu diesem Zeitpunkt war er 26 Jahre alt. Heute erinnert eine Gedenktafel vor der Marc-Aurel-Strasse 5 an ihn.
Leo Luster gab mir im Cafe Schottenring seine Visitenkarte und lud mich ein, den österreichischen Seniorenclub in Tel Aviv zu besuchen. Viele Jahre später flog ich nach Tel Aviv, um drei Lebensgeschichten aufzuschreiben.
Leo Luster hatte sich sofort bereit erklärt, mir ein Interview zu geben. Ich besuchte ihn in seiner Wohnung, und es begann eine wunderbare Freundschaft.
- Meine Familiengeschichte
- Meine Kindheit
- Nach dem Anschluss 1938
- Nach dem Krieg
- Rückkehr nach Wien
- Deggendorf
- Israel
- Meine Frau Shoshana
- Die politische Lage in Israel
- Glossar
- Meine Familiengeschichte
Die Familie meiner Mutter lebte in Galizien, in der Stadt Brzesko [Polen]. Der Großvater hieß Berisch Teichthal, die Großmutter Feigel Cerl Dorflaufer. Meine Großmutter wurde 1854 in Brzesko geboren. Geheiratet haben meine Großeltern 1876 in Brzesko. Sie haben jüdisch geheiratet, so bekamen die Töchter den Namen der Mutter und die Söhne den Namen des Vaters.
Sie hatten zwölf Kinder, von denen acht am Leben geblieben sind. Ich kannte drei von ihnen: meine Mutter Golda, die am 18. Januar 1892 geboren wurde, ihren Bruder Josef Benjamin, der am 5. Juli 1896 geboren wurde und Hinda Rifka, die am 6. Januar 1899 in Brzesko geboren wurde. Jaques wanderte nach Amerika aus, den konnte ich nur noch auf dem Friedhof in New York besuchen.
Die anderen Brüder und Schwestern meiner Mutter habe ich nie gesehen. Sie blieben in Polen und sind während des Krieges dort ermordet worden. Einige ihrer Namen kenne ich. Sie hießen: Israel, Neche, Marjem, Leser Lipe, Abraham und Jakob. Jacob war dann in Amerika, nehme ich an, Jaques.
Was ich über meine Großeltern erzählen kann, ist nur vom Hörensagen, das, was meine Mutter mir erzählt hat: meine Großeltern haben eine sehr glückliche Ehe geführt. Mein Großvater war ein Reisender, der mit Seife gehandelt hat. Er hat in Deutschland Seife eingekauft und mit Pferdefuhrwerken nach Polen gebracht.
Das Komische an der Geschichte ist, wie ich in Deutschland rumgefahren bin, bin ich draufgekommen, dass mein Großvater, der sehr fromm war, anscheinend immer bis nach Rothenburg ob der Tauber gekommen ist. Rothenburg ob der Tauber ist eine interessante Stadt. Da hat nämlich der große Rabbiner von Rothenburg gelebt. Er hatte dort eine große Jeschiwa 1, und da sind viele hingekommen, die ihn sehr verehrt haben.
Er hat viel geschrieben, war ein sehr bekannter Mann, der Rabbi von Rothenburg. Und scheinbar ist mein Großvater immer zu ihm hingefahren, weil er oft ein halbes Jahr weggeblieben ist von zu Hause mit seinem Pferd und seinem Wagen. Wenn er dann zurückgekommen ist, was hat er gebracht? Seife! Dort in Rothenburg war nämlich eine Seifenfabrik, und dort hat er die Seife gekauft und sie nach Polen mitgebracht und sie dann verkauft.
Auf diesem Weg hat ihn immer einer von seinen Brüdern begleitet. Er hat wahrscheinlich mehrere Brüder gehabt, ich weiß nicht, auf jeden Fall ist er nicht allein gefahren, und sie sind immer auch zu diesem Rabbi gefahren. Das habe ich aber erst nach dem Krieg erfahren. Meinen Großeltern ist es scheinbar nicht schlecht gegangen, der Großvater hat mit der Seife einigermaßen gut verdient.
Erzählt hat man mir, dass meine Großmutter eine kleine Frau war, die einen Sheitl 2 trug. Man hat sie sehr verehrt, weil sie sehr klug war. Leider war sie zuckerkrank. Schon damals sind auch die Zuckerkranken nach Karlsbad [Karlovy Vary, heute Tschechien] geschickt worden, das Heilwasser dort hat auch den Zuckerkranken geholfen. Jedenfalls ist die Großmutter im Sommer immer nach Karlsbad zur Kur gefahren, und daraus schließe ich, dass der Großvater sich das leisten konnte. Mein Onkel Benjamin hat meiner Großmutter in Wien Insulin gegen die Diabetes gekauft, aber es war schon für sie zu spät, es hat nicht mehr geholfen. Sie starb 1924 und liegt am Zentralfriedhof begraben.
Mein Großvater ist schon vor dem 1. Weltkrieg gestorben, deshalb ist meine Großmutter Ende 1914, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, allein mit ihren drei jüngsten Kindern, meiner Mutter Golda, ihrem Bruder Benjamin und ihrer Schwester Rifka, die erst 15 Jahre alt war, nach Wien geflüchtet.
Damals war das leicht, denn es gab keine Grenzen. Wien war die Hauptstadt der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Und weil sich der Krieg in ihrer Gegend abgespielt hat, fühlte sich meine Großmutter in Wien viel sicherer mit ihren Kindern. Ein älterer Bruder meiner Mutter, Jaques, wanderte zu dieser Zeit, vielleicht auch schon früher, nach Amerika aus.
Meine Großmutter hat mit ihren Kindern zuerst in der Tandelmaktgasse 19 [2. Bezirk] gewohnt.
Meine Tante Rifka heiratete in Wien Naftali Herz Lauer aus Brody [heute Ukraine]. Ihr Sohn Alexander wurde 1926 in Wien geboren.
Meine Großmutter hatte eine Schwester, sie hieß Rojzie Dorflaufer. Sie war 1865 in Brzesko geboren und mit Naftali Benjamin Goldberg verheiratet. Sie starb 1938 in Wien, ihr Mann wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert. Die Tochter Gittel Rifka Goldberg, die 1886 in Brzesko geboren wurde, hatte 1909 David Teichthal geheiratet. Beide wurden in Auschwitz ermordet. Ihre Tochter Sara starb 1986 in New York, ihr war die Flucht gelungen,
Mein Onkel Benjamin war ein tüchtiger Kopf, die ganze Familie hat ihn gern gehabt. Er war sportlich und politisch engagiert als Sozialist und Zionist. Er wurde erfolgreicher Pelzhändler in Wien. Geheiratet hat er 1925 Bertha Ladenheim, eine sehr nette Frau.
Ihr Vater Elias Elukim Ladenheim war auch Pelzhändler, er hatte ein großes Geschäft im 20. Bezirk, in der Heinzelmanngasse. Ihre Tochter Renee wurde 1926 in Wien geboren.
Onkel Benjamin hatte eine wunderschöne Vierzimmerwohnung, ein ganzes Stockwerk war das, im 9. Bezirk, in der Glasergasse 3, Ecke Porzellangasse. Sie hatten auch ein Dienstmädchen. Ich war sehr oft bei ihnen zu Besuch. Es hat mir sehr gut bei meinem Onkel gefallen. Auch meine Mutter hat ihren Bruder geliebt, er hat jedem geholfen, er hat jedem was gegeben.
Wie der Hitler in Österreich einmarschiert ist, hat Onkel Benjamin Angst bekommen, die Wohnung zugesperrt, alles dort gelassen und ist mit seiner Familie weggelaufen. Das Dienstmädel hatte einen Freund, das war ein SS-Mann, der hat alles genommen. Onkel Benjamin hatte eine Buchhaltung in Innsbruck, und der Buchhalter hat sie über die Grenze nach Italien geschmuggelt. Sie waren ungefähr ein Jahr in Italien und sind dann nach Frankreich weiter geflüchtet und haben in Paris gelebt.
Onkel Benjamin hatte scheinbar im Ausland etwas Geld, und dadurch konnten sie sich über Wasser halten in dieser Zeit. Aus Frankreich sind sie dann weiter in die USA geflüchtet. Der Bruder Jacques, der aus Polen nach Amerika ausgewandert war, hat ihnen ein Affidavid 3 nach Frankreich geschickt.
So konnte Benjamin mit seiner Familie in die USA einreisen und dort leben. Onkel Benjamin ist 1943 in den USA an Krebs gestorben. Tante Bertha hat später einen Herrn Podhorzer geheiratet. Die Tochter Renee lebt noch in den USA.
Die Eltern meines Vaters hießen Leiser Isak Luster, geboren 1849 und Ite Jütel, geborene Seitelbach, geboren 1855. Beide wurden in Jarosław [Galizien, heute Polen], geboren und lebten dort. Wann sie nach Wien übersiedelt sind, weiss ich nicht. Der Großvater war Hausierer und starb 1899 in Wien, im Kaiser Josef-Spital.
Die Großmutter Jütel starb 1923 in Wien, im 20. Bezirk, in der Hannovergasse 7, wo sie gelebt hatte. Sie hatten sieben Kinder:
Sara Luster wurde 1875 in Jarosław geboren. 1901 heiratete sie den aus Russland stammenden Hersch Wolf Rosenbaum. Sara und ihr Ehemann hatten zwei Kinder: Alois Rosenbaum, der 1903 in Wien geboren wurde und Dora, verheiratete Strum.
Saras Mann starb am 23. Mai 1939 in Wien, im 13. Bezirk, im Versorgungsheim Lainz. Sara starb 1944 in Theresienstadt. Sie war 69 Jahre alt.
Das zweite Kind der Großeltern war Abraham Isak Luster. Er starb als Einjähriger 1877 in Jarosław.
Mechel Luster wurde 1879 in Jarosław geboren und starb im Alter von zwei Jahren.
Simon Leib Luster wurde 1881 in Jarosław geboren. Er lebte mit seiner Frau Fanny, geb. Rubin, in Mannheim und dort ist er auch gestorben. Fanny wurde ins KZ Auschwitz deportiert und ermordet, der Sohn, der auch Leo hieß, konnte wahrscheinlich flüchten. Ich hab nie wieder etwas von ihm gehört.
Schulem Luster wurde 1883 in Jarosław geboren. Auch er wurde nur ein Jahr alt.
Scheindel Luster wurde 1886 in Jarosław geboren und starb 1918 in Wien 20, Hannovergasse 7.
Mein Vater Moses Luster wurde am 15. März 1891 in Jarosław geboren. Er hatte noch einen Bruder, der in Jaroslaw mit seiner Frau, einer Tochter und einem Sohn gelebt hat. Was mit denen passiert ist, weiss ich bis heute nicht. Ob sie umgekommen sind durch die Deutschen oder nach Russland geflüchtet sind, weiss ich nicht. Ich habe nie mehr etwas von ihnen gehört.
Meine Eltern haben sich durch ein Schadchen 4 kennengelernt. Das war, wie man auf Jiddisch sagt, ein Schidach 5. Sie haben 1920 in Wien, im Polnischen Tempel, in der Leopoldsgasse 29, geheiratet. Ich besitze sogar das Trauungsbild meiner Eltern.
- Meine Kindheit
Wir haben in der Schreygasse 12, im 2. Bezirk, gewohnt. Die Schreygasse ist eine Seitengasse der Unteren Augartenstraße. Ungefähr siebzig Prozent der Leute in den Wohnungen in unserem Haus waren Juden. Das Haus hatte einem Juden gehört, einem gewissen Herrn Toch. Der Herr Toch hat, glaub ich, in der Gasse drei Häuser besessen.
In unserer Wohnung war ein großes Zimmer, ein kleines Zimmer, das war das Kabinett, in dem meine Schwester und ich schliefen, und eine Küche. Meine Schwester Helene, Helli haben wir sie genannt, ist 1921 geboren. Ich bin 1927 geboren, war sechs Jahre jünger als meine Schwester. Helli hat sich viel um mich gekümmert, wir hatten eine gute Beziehung zueinander.
Ich ging in einen jüdischen Kindergarten, der nicht allzu weit von uns entfernt, in der Schiffamtsgasse, war. Meine Mutter war zu Hause, aber man hat die Kinder in den Kindergarten geschickt. Die Kindergärtnerin, eine französische Jüdin, hat nur Französisch mit uns gesprochen. Das war vielleicht damals schon modern. Dadurch kannte ich als Kind viele französische Worte. Später habe ich aber alles wieder vergessen.
Mein Vater wollte, dass ich beten kann, dass ich alle Gebete lerne. Darum ging ich mit vier Jahren jede Woche in einen Cheder 6 in der Nestroygasse. Der Cheder war sehr nahe unserer Wohnung. Da hab ich Chumesch 7 gelernt, das Alef Beth [Anm.: hebräische Alphabet] und hebräisch schreiben. In meiner Klasse waren zumindest zwanzig bis fünfundzwanzig jüdische Kinder, denn in meiner Wohngegend wohnten viele jüdische Familien.
Meine Eltern hatten Freundschaften mit Leuten in unserer Umgebung, und wir hatten sogar Verwandte in der Nähe. Uns gegenüber wohnten Cousinen meiner Mutter. Mit deren Kindern bin ich immer zusammengekommen.
Antisemitismus haben wir damals schon sehr deutlich gespürt. Wir haben auf der Straße Fussball gespielt, damals gab es noch kaum Autos, die Straßen waren leer. Da sind oft die christlichen Kinder gekommen und haben uns vertrieben oder verprügelt. Wir hatten keinen guten Kontakt mit diesen Kindern.
Das war schon so, als ich noch klein war. In die Schule sind wir später nie allein gegangen, sondern immer in Gruppen, damit man uns nicht überfallen kann. Das war grad die mieseste Zeit in Österreich. Das war nach dem 1. Weltkrieg während der großen Wirtschaftskrise. Da wurde den Leuten eingeredet, die Juden haben das Geld, während überall Armut herrschte. Da gab es wirklich einen großen Antisemitismus. Das war der geistige Beginn von Adolf Hitler.
Mein Vater hatte von einer Textilfabrik eine Vertretung in Gänserndorf. Ich erinnere mich heute noch an den Namen der Textilfabrik, sie hiess Marek und war auf der Oberen Donaustraße. Er hat Waren in Gänserndorf verkauft. Warum in Gänserndorf? In Gänserndorf haben sehr viele ehemalige Eisenbahner gelebt.
Das waren Leute die Geld hatten, weil sie bei der Eisenbahn ein gutes Gehalt hatten und die Wohnungen billig bekommen haben. Bevor Hitler kam, hatten diese Leute aber trotzdem auch eine Menge Schulden bei meinem Vater, denn es gab damals die Ratenzahlung. Keiner hat nach dem Einmarsch der Deutschen noch was bezahlt. So haben wir alles verloren.
Zusätzlich zu seiner Arbeit hatte mein Vater manchmal noch einen Job als Schamasch 8 zu Hochzeiten und Bar Mitzwas 9 im Polnischen Tempel. Onkel Noah, ein Onkel meiner Mutter, vom Großvater der Bruder, war in diesem Tempel der Gabei. Das waren die, die den Tempel geleitet haben, er war sozusagen der Vorsitzende von dem Tempel. Und der Mann der Schwester meiner Großmutter war auch dort.
Durch die hat mein Vater diesen Extrajob bekommen. Der Polnische Tempel war ein sehr, sehr populärer Tempel, in den viele Leute gegangen sind. Sie hatten dort nämlich einen fantastischen Kantor, einen Chasan, der sehr bekannt war. Das war ein gewisser Fränkel. Zu ihm sind viele gekommen um ihn zu ehren.
Es wurde sogar hier in Israel etwas über ihn veröffentlicht, und auch ich habe etwas über ihn geschrieben. Ich bin natürlich gern in den Tempel gegangen. Da gab es auch einen Chor, es war sehr, sehr schön, das war ein angenehmer Gottesdienst. Am Schabbat sind wir immer in den Tempel gegangen, wir waren immer mit den anderen zusammen. Der Polnische Tempel war das Zentrum, wo man sich getroffen hat.
Von der Schule aus mussten wir Samstagnachmittag zum Schabbat – Gottesdienst. Das war Pflicht, weil wir frei bekommen haben, wenn die christlichen Kinder über Katholizismus gelernt haben. So wurde das zeitlich ausgeglichen. Dieser Gottesdienst fand im großen Tempel [Leopoldstädter Tempel] in der Tempelgasse statt. Das war der größte Tempel von Wien, und dort war es schon ein bisschen fortschrittlich.
Ich bin die ersten vier Klassen in die Talmud Thora- Schule in der Malzgasse 16 gegangen. Das ist eine sehr fromme Schule, die existiert heute noch. Vor zwei Jahren habe ich mit ein paar ehemaligen Freunden aus Wien einen Film in Wien gemacht. Da war ich das erste Mal seit 1938 wieder in der Schule in der Malzgasse.
Während des Krieges war in dem Haus ein Spital, jetzt ist dort wieder eine Schule. Ich habe zu weinen begonnen, wie ich das gesehen habe, an alles habe ich mich erinnert. Ich habe die Kinder vor mir gesehen - es war schrecklich! Mit dem Lehrer Ludwig Tauber, er war sehr orthodox, habe ich in Israel noch Kontakt gehabt. Ich glaube, er war in der Malzgasse bis 1939 Lehrer, er hat drei Klassen unterrichtet.
Er hat alles unterrichtet, was zu unterrichten war. Er schaffte es, nach Palästina zu flüchten. In Israel hat er dann in Bnai Brak gelebt. Ich hatte erfahren, dass er am Leben ist und habe ihn aufgesucht. Er war auch bei mir im Büro. Er ist mit seinem Sohn zu mir ins Büro gekommen.
Die nächsten vier Jahre war ich in der Vereinsgasse in der Hauptschule, dann in der Sperlgasse auf dem Gymnasium. Ich war ein mittelmäßiger Schüler. Ich hab es mir leicht gemacht, ich hatte eine schnelle Auffassung, hab schnell gelernt. Wir jüdischen Kinder sind in den christlichen Schulen immer von den Lehrern benachteiligt worden.
Man hat uns auf unsere Arbeiten schlechtere Noten gegeben. Wir wurden nicht akzeptiert, aber wir haben damit gelebt. Wir waren doch eine Minderheit. Wir waren zufrieden, wenn man uns in Ruh liess, wir waren sehr geduldig. Wir mussten uns damit abfinden.
Das war unser Schicksal, wir konnten das nicht ändern. Wie dann der Hitler schon dagewesen ist, ging ich in die JUAL-Schule 10, in der Marc-Aurel-Strasse 5. Das war eine Vorbereitungsschule für die Auswanderung nach Palästina.
Meine Eltern sind sehr oft in jüdische Theater gegangen. Es gab die Jüdischen Künstlerspiele 11 am Nestroyplatz 1, das existiert heute wieder. Da waren immer jüdische Künstler. Und in der Taborstraße war die Jüdische Bühne. Es gab damals sehr viele Gastspiele aus aller Welt in diesen Theatern.
Wo heute in der Taborstrasse das Hotel Central ist, war ein riesiger Saal im Keller, indem viele Feiern - Hochzeiten oder Zusammenkünfte von Zionisten - stattgefunden haben. Da sind meine Eltern mit uns immer hin gegangen. Dann gab es in der Rotensterngasse ein bekanntes jüdisches Restaurant, dessen Besitzer dann später in Tel Aviv ein Restaurant eröffnet hat. Dort sind wir manchmal essen gegangen. Als er starb haben seine Frau und sein Sohn das Restaurant weitergeführt.
Und es gab das Restaurant Marschak, ein sehr gutes Restaurant gegenüber der Schiffschul [Synagoge im 2. Bezirk] in der Schiffamtsgasse. Das war ein riesiges Lokal. Dort sind die Leute zum Kiddusch 12 hingegangen. Dort gab es gutes Essen, gefillte Fisch zum Beispiel.
Dann gab es das sehr bekannte Café Buchsbaum in der kleinen Pfarrgasse, Ecke große Sperlgasse. Das war ein großes Kaffeehaus, da haben viele Juden sich getroffen und Karten gespielt. Auch mein Vater hat dort Karten gespielt. Dann war das große jüdische Café Sperl, das war in der Großen Sperlgasse, Ecke Haidgasse. Das existiert heute, glaube ich, nicht mehr.
Es gab damals in dieser Gegend sehr viele jüdische Lokale, in denen sich Juden getroffen haben, denn man hat sich mit Freunden draußen getroffen.
Freitags zum Schabbatgottesdienst sind meine Eltern immer in den Tempel gegangen. Nach dem Gottesdienst haben wir uns oft bei meinem Onkel Benjamin getroffen, denn er hatte ja eine große Wohnung. Da war die ganze Mischpoche [jiddisch für Familie] zusammen. Die Kinder waren immer dabei. Wenn wir aber nach dem Gottesdienst nach Hause gegangen sind, hatte meine Mutter für uns alles vorbereitet: Suppe, Fisch und Huhn. Meine Mutter war eine sehr gute Köchin. Vor dem Essen hat sie die Kerzen gezündet.
Zu Pessach 13 hatten wir Pessach-Geschirr. Das stand am Dachboden, und nur zu Pessach wurde es heruntergenommen. Das Geschirr wurde ausgetauscht, das hat meine Mutter streng eingehalten, da war sie sehr koscher 14, das hat sie gemacht. In unserer Gegend gab es sehr viele koschere Geschäfte, zum Beispiel hat es ein Geschäft in der Haidgasse gegeben, das hat geheissen Eisen.
Wunderbare Wurst hat der gemacht! Und es hat in der großen Pfarrgasse ein jüdisches Lebensmittelgeschäft gegeben, Wieselberg hat der geheissen. Wenn man kein Geld hatte, konnte man anschreiben lassen, später hat man bezahlt. Da konnte man alle koscheren Lebensmittel bekommen. Da gab es auch so einen komischen Kaffeeersatz mit Zichorie. Frank-Kaffee hat die jüdische Firma geheissen, die den hergestellt hat.
Dann war das große Geschäft in der Leopoldsgasse, wo man Matzes 15 gekauft hat, der hat geheissen Strum. Strum war eine Fabrik, eine Matzesfabrik; Strum Matzes. Die Strum Matzes Fabrik war eine sehr bekannte Fabrik. Meine Cousine Dora, die Tochter meiner Tante Sara, der Schwester meines Vaters, hat in Amerika den Sohn des Besitzers Strum geheiratet.
Zu Pessach hat man Matzes gekauft, die war aber nicht billig. Die Auswahl war auch nicht so groß wie heute. Die sephardischen 16 Juden dürfen Reis und Hülsenfrüchte essen, die ashkenasischen 17 Juden nicht. Die Nudeln hat meine Mutter selber gemacht aus Matzesmehl und verschiedenen anderen Sachen. Sie hat auch Lekach [Honigkuchen] gebacken aus Matzemehl oder Erdäpfelstärke.
Wir haben uns gut gefühlt, bis der Antisemitismus größer wurde. 1936 sind viele unserer Bekannten aus unserem Haus nach Palästina ausgewandert. Manche Zionisten sind noch früher ausgewandert.
Meine Schwester war schon sehr früh in der zionistischen Organisation Hanoar-Hazioni, sie war auch ein ein biss’l zionistisch eingestellt. Ich war später in der zionistischen Organisation Gordonia. Aron Menczer 18 war unser Madrich [hebr. Leiter, Erzieher].
Als ich zur Jugendorganisation Gordonia kam, war ich zwölf Jahre alt. Wir haben gemeinsam Ausflüge gemacht, uns wurde über Palästina erzählt, wir wurden zu Zionisten erzogen. Man hat uns gesagt: hier ist nicht eure Heimat, eure Heimat ist Israel. Mein Traum war es immer nach Israel zu gehen, und wenn Hitler nicht gekommen wäre, wäre ich vielleicht auch nach Israel ausgewandert.
Meine Eltern hatten damit kein Problem, ganz im Gegenteil, sie waren sehr dafür. Ich glaube sogar, meine Eltern wären auch nach Palästina ausgewandert, denn mein Vater und meine Mutter waren keine österreichischen Patrioten.
Sie waren zufrieden mit ihrem Leben in Österreich. Wenn sie ihr Leben in Wien mit ihrem Leben in Polen verglichen, woher sie ja gekommen waren, ging es ihnen in Wien besser. Zwischen ihrem Leben in Galizien und ihrem Leben in Wien gab es einen großen Unterschied. Meine Mutter zum Beispiel kam aus einem ganz kleinen Städtele, ich habe es nach dem Krieg gesehen.
Diese Städtel waren sehr arm, da gab es nicht viel; Wien dagegen war die Hauptstadt. Die jüdische Gemeinde in Österreich zählte zu Beginn des 1. Weltkriegs etwas über 200.000 Mitglieder. Das war eine große jüdische Gemeinde. Viele dieser Menschen haben sehr viel für Österreich geleistet.
Die bereits in Wien ansässigen Juden haben auf uns polnische Juden runtergeschaut. Sie waren assimiliert, sie waren schon Wiener, und sie haben gemeint, sie sind gute Österreicher, ihnen kann nichts mehr passieren. Sie hatten Angst vor verstärktem Antisemitismus durch die orthodoxen Juden aus den Städteln, denen man das „Jude sein“ so deutlich ansah.
Alle die aus Polen gekommen sind haben Jiddisch gesprochen und nicht Deutsch. Die eingesessenen Wiener Juden haben sich wirklich nicht sehr schön benommen zu den Neueinwanderern. Sie haben sich geschämt für diese Juden. Aber viele von uns haben es sehr weit gebracht, obwohl sie von dort gekommen sind. Das sage ich nicht im Nachhinein, das haben wir immer gefühlt.
Man hat uns immer fühlen lassen, dass wir nicht dazu gehören. Meine Mutter hat Deutsch mit sehr stark jiddischem Akzent gesprochen. Sie wollte nirgendwo allein hingehen, sie ist manchmal mit meiner Schwester gegangen oder mit mir, und wir haben für sie gesprochen und erklärt, was sie will. Mein Vater hat besser Deutsch gesprochen als meine Mutter, und mein Onkel Benjamin hat ein tadelloses wunderbares Deutsch gesprochen. Ihm hat man nicht angemerkt, dass er aus Galizien kam.
Meine Schwester wurde Lehrmädchen in einem jüdischen Schneidersalon in der Rotenturmstrasse 14. Das Haus existiert noch. Dadurch, dass die Lehrmädchen die Waren austragen mussten, ist sie sehr viel in Wien herumgekommen.
Meine Schwester hat Kleider in Villen gebracht. Sie kam in wohlhabende Häuser, wo die Damen in Schneidersalons nähen ließen. Das waren Wiener Juden, die schon lange in Wien gelebt haben, die schon assimiliert waren.
Ich bin als Kind gern und viel ins Kino gegangen. Ein entfernter Cousin meiner Mutter besaß ein Kino in der Unteren Augartenstraße, da konnte ich umsonst hinein, und vor unserem Haus in der Schreygasse war das Rembrandtkino. Ich erinnere mich noch an die Filme mit Dick und Doof, das waren Stan Laurel und Oliver Hardy. Und an Charlie Chaplin Filme erinnere ich mich auch.
Mein Vater hat gern die Zeitung gelesen. Wo ist man gegangen in Wien Zeitung lesen? Ins Kaffeehaus! Er war entweder im Cafe Buchsbaum oder im Cafe Sperl. Da hat er einen Kaffee und ein Glas Wasser getrunken und die Zeitungen gelesen. Mein Vater hat auch oft und gern Witze erzählt.
Während des 1. Weltkriegs hat mein Vater bei der Militärpolizei am Nordbahnhof [Anm.: heute Praterstern] gearbeitet. Der Nordbahnhof war in der Habsburgermonarchie der größte Bahnhof Wiens mit den wichtigsten Verbindungen nach Brünn, Kattowitz, Krakau und Lemberg.
Für viele Zuwanderer aus den Kronländern Galizien, Bukowina, Böhmen und Mähren war er das Tor nach Wien. Dort hat mein Vater die Ankommenden kontrolliert. Er hat ein biss’l Ungarisch, ein biss’l Polnisch und ein biss’l Russisch gesprochen und gesagt, dass er die Sprachen beim Militär gelernt hat.
Er hat oft Geschichten über diese Zeit erzählt. Damals wurden viele Lebensmittel geschmuggelt, weil die Menschen gehungert gaben. Zum Beispiel haben Frauen Eier unter ihrem Hut geschmuggelt, und einmal hat einer von der Militärpolizei einer Frau auf den Hut gehauen, und was da passiert ist, kann man sich vorstellen. Das war sehr lustig für mich, mir das vorzustellen.
Ein Kriegsbegeisterter, wie viele, die erst während des Krieges Kriegsgegner wurden, war mein Vater nicht. Ich weiß nicht, wo er politisch gestanden ist, ob er Sozialist war, aber ich glaube nicht. Meine Eltern waren hauptsächlich daran interessiert, was mit Juden zu tun hatte.
Als Kind habe ich mir mit meinen Freunden selber einen Detektorempfänger gebaut. Der bestand aus einer Spule, einem Kristall und Kopfhörern. Damit konnten wir Radio hören. Das war sehr aufregend. Aber meine Eltern besaßen auch ein Radio.
Diesen Radioapparat mussten wir nach dem Einmarsch der Deutschen abgeben. Alle Radioapparate wurden den Juden weggenommen.
Die Juden gehen ja am Schabbat in den Tempel, und nach dem Gottesdienst gibt es einen Kiddusch 19, da bekommt man etwas zu essen und redet miteinander. Das ist jüdischer Brauch, besonders in Wien wird das so gemacht.
Viele Juden waren nach Hitlers Machtübernahme im Januar 1933 aus Deutschland nach Österreich geflüchtet. Einige kamen auch in den Tempel, in dem mein Vater war und haben erzählt, was sich in Deutschland abspielt. Mein Vater hat ihnen das alles geglaubt. Er wusste, sie erzählen keine Märchen. Aber es gab auch viele Juden, die haben denen kein Wort geglaubt.
Außerdem waren sie sich sicher, dass in Österreich so was nie passieren kann. Mein Vater hat uns zu Hause immer darüber erzählt.
- Während des Krieges
Ich erinnere mich wie heute. Der 11. März 1938 war ein Freitag. Ich war mit meinem Vater am Abend in der Synagoge. Auf dem Weg von der Synagoge nach Hause, hielt uns ein Nachbar auf:
‚Herr Luster, kommen Sie herein. Es ist etwas Schreckliches passiert.’
‚Was ist passiert?’
‚ Der Schuschnigg 20 ist zurückgetreten.’
Als mein Vater erfuhr, dass der österreichische Bundeskanzler zurückgetreten ist, war ihm klar, jetzt fängt unser Unglück an. Ich erinnere mich noch genau an seine Worte:
‚Jetzt fangt unser Unglück an.’ Und so war es! Schuschnigg ist zurückgetreten, und am Samstag sind schon auf der Strasse die Leute mit den Hakenkreuzbinden herum gelaufen, und man hat schon die Juden gesucht. Gleich an dem Samstag!
Mein Vater hat sofort nach Einmarsch der Deutschen seine Arbeit verloren. Die Juden haben bald verstanden, hier können wir nicht bleiben, wir müssen hier raus. Aber das war damals ein großes Problem. Die Deutschen haben sofort alle Regierungsfunktionen mit ihren Leuten besetzt, das ging sehr, sehr schnell.
Auch die Polizei haben sie übernommen. Sie haben genau gewusst, wer wo wohnt, wer reich ist und wer arm ist. Sie haben die Juden eingekreist und ihnen alles weggenommen. Es hat keine jüdischen Geschäfte mehr gegeben, alles war aus. Mein Vater wollte nach Amerika auswandern.
Er hat geglaubt, dass der Bruder meiner Mutter uns helfen wird, aber das war nicht so. Zum Glück bekam er einen Posten als Ordner bei der Fürsorge in der Kultusgemeinde. Somit war er für Soziales mitverantwortlich, denn die Kultusgemeinde hat soweit es ihnen möglich war, die Juden unterstützt.
Mein Freund Edi Tennenbaum wohnte uns genau gegenüber. Er konnte 1939 mit einem Kindertransport nach England flüchten. Seine Eltern waren aus Riga. Ich habe nie wieder etwas von Edi gehört. Ich hatte noch einen Freund, das war der Julius Nussbaum, Bubi haben wir ihn genannt.
Sein Vater hatte ein Schneidergeschäft in der Miesbachgasse, im 2. Bezirk. Wir waren zusammen in der JUAL - Schule. Seinen Bruder habe ich später in Tel Aviv wieder getroffen. Mein Freund Bubi wurde 1943 vom Ghetto Theresienstadt ins KZ Auschwitz deportiert und ermordet. Der Bruder war zu mir ins Büro gekommen und hat mir alles erzählt.
Als er starb, habe ich seiner Witwe geholfen, dass sie eine Witwenpension aus Österreich bekommt, denn ich arbeite seit vielen Jahren in einer kleinen Organisation, dem ‚Zentralkomitees der Juden aus Österreich in Israel’, die sich sehr bemüht, für österreichische Überlebende und ihr Kinder Gerechtigkeit vom österreichischen Staat zu bekommen.
Am 10. November 1938, nach der Pogromnacht 21, der sogenannten ‚Kristallnacht’, wurde mein Vater verhaftet und eingesperrt. Unsere Wohnung war im dritten Stock. In dem Haus, in dem wir wohnten, gab es auch eine Kellerwohnung ohne Licht, ohne Strom und Wasser und ohne eine Toilette.
Das war eine Einzimmer-Wohnung mit einer kleinen Küchenecke. In dieser Wohnung wohnte ein Mann, ein illegaler Nazi. Er kam zu uns in die Wohnung rauf, und hat gesagt, dass wir die Wohnung räumen müssen. Er hat uns aus unserer Wohnung rausgeschmissen.
Als er kam, waren nur meine Schwester und ich zu Hause. Wir mussten unsere Sachen aus der Wohnung nehmen, die, die wir tragen konnten und in die Kellerwohnung gehen. Er ist einfach raufgegangen und hat uns unsere Wohnung weggenommen.
Und wir haben dann dort gewohnt. Wir hatten dort nur eine Petroleumlampe, und das Wasser mussten wir vom Gang holen. Ich glaube, mein Onkel Benjamin war es, der mir einmal einen Fotoapparat geschenkt hat. Ich habe gern und viel fotografiert, so auch meine Eltern im Lichthof vor dieser Wohnung.
Als mein Vater freigekommen ist, wurde es dann ein biss’l leichter für uns. Er war ganz zerschlagen, er hat erzählt, warum. Die hatten ihm gesagt, er darf mit Niemandem darüber reden, was er erlebt hat. Man hatte die Leute dort gequält und geschlagen.
Mein Vater hatte seine Arbeit als Vertreter verloren
Wir haben ungefähr eineinhalb Jahre in dieser Kellerwohnung gewohnt. Mein Vater ist wieder zu seiner Arbeit in die Kultusgemeinde gegangen. Als die Deportationen begannen, ist es meinem Vater gelungen, eine zwei Zimmerwohnung in der Flossgasse für uns zu bekommen.
Das letzte Jahr in Wien mussten wir nicht mehr in der Kellerwohnung leben. Meine Schwester war zu dieser Zeit bereits weggefahren. Mein Vater hatte 1940 durch die Kultusgemeinde die Möglichkeit, sie in einem der illegalen Transporte nach Palästina unterzubringen.
Man musste dafür Geld bezahlen, die Leute mussten sich einkaufen. Im Herbst 1940 ist sie weg von Wien. Sie brauchte einen Pass und ein Visum. Dann ist sie nach Bratislava gefahren. In Bratislava lernte sie ihren tschechischen Mann, Israel Mayerowicz, einen Tischler, kennen. Sie haben noch in Bratislava geheiratet.
Für die Heirat musste meine Schwester die Bewilligung meines Vaters bekommen, denn sie war noch keine 18 Jahre alt. Das Schiff ist dann nach einiger Zeit von Bratislava über Rumänien nach Palästina gefahren. Das war eine schreckliche Odyssee bis sie nach vielen Wochen den Hafen von Haifa erreichten, das Schiff in einem entsetzlichen Zustand.
Die Passagiere wurden aufgefordert auf das Schiff Patria, das neben ihnen im Hafen lag, umzusteigen. Die Patria wurde wenig später von der Hagana [paramilitärische Vereinigung] im Hafen gesprengt, damit die Flüchtlinge von den Engländern nicht weiter nach Mauritius geschickt werden konnten.
Eigentlich sollte nur das Schiff beschädigt werden, aber viele Geflüchtete starben dabei. Meine Schwester hat zum Glück überlebt. Sie haben drei Töchter bekommen, Ruth, Ora und Pessy. Israel starb 1988, meine Schwester starb 2009 in Hadera. Die Töchter leben alle drei in Israel.
Meine Schwester hatte viele Freundinnen, eine Freundin war eine weitläufig Verwandte, sie hieß Stella Monderer, ist 1936 nach Palästina ausgewandert und 1938 auf eine kurze Zeit noch mal nach Wien zu ihrer Mutter gekommen. Aber sie ist dann gleich wieder zurück, sie hatte einen palästinensischen Pass.
Ihre Mutter flüchtete nach Südfrankreich und hat den Krieg dort überlebt. Mit Stella war meine Schwester ihr Leben lang im Kontakt. Ein Freund meiner Schwester war später in Israel General und Adjutant von Ben Gurion. Aber er ist mit einem Flugzeug in Addis Abeba [Äthiopien] abgestürzt. Sein Sohn war viel später einmal bei mir im Büro, und ich habe ihm gesagt, dass meine Schwester eine Freundin seines Vaters war.
Als meine Schwester schon nicht mehr in Wien war, hatte ich mit ihren Freundinnen, die in Wien geblieben waren, noch Kontakt. Alle diese Freundinnen sind nach Polen deportiert und ermordet worden.
Meine Mutter war eine Selfmadefrau. Sie hat immer, in jeder Situation, ‚ihren Mann’ gestanden. Auch später im Lager war das so. Sie hat sich immer auf ihre eigenen Füße stellen können. Sie konnte auch aus fast nichts ein Essen zaubern.
Im Jahre 1940, es gab nur noch den Wiener Stadttempel, die anderen waren alle zerstört worden, hat mein Vater aus der Umgebung zehn Leute zusammengerufen, das ist ein Minjan 22, und man hat mir in der Wohnung, in der wir gewohnt haben, eine Bar Mitzwa gemacht.
Ich bin ab 1940 in zwei Schulen gegangen, in die Sperlgasse und am Nachmittag in die JUAL-Schule, die Jugendvorbereitungsschule für Palästina, in der Marc-Aurel-Strasse 5. Als ich in der Sperlgasse 1941 die letzte Klasse beendet hatte, hat man aus der Schule ein Deportationslager gemacht. Ich war 14 Jahre alt und in der 8. Klasse.
In der Zeit, als wir jüdischen Kinder überhaupt nicht mehr in die Schule gehen durften, hatten wir in der JUAL-Schule verschiedene Professoren. Hauptsächlich haben wir über Zionismus gelernt. Ich habe damals viel gelesen, auch politische Bücher.
Die Bücher habe ich in der Schulbibliothek ausgeliehen. Viele Bücher von Sholem Asch waren dabei. Sholem Asch stammte aus Polen. Es gibt in Tel Aviv ein Sholem Asch-Haus.
Bis zu unserer Deportation ging ich in diese Schule.
Die Schule war mein Glück damals, ich war in Sicherheit, hatte Gesellschaft und war gut aufgehoben. Einige meiner Freunde damals waren Kurt Weigel, Berthold Mandel, Harry Linser, Berisch Müller, Walter Teich, Ehrlich, seine Vornamen habe ich vergessen, Kurt Salzer, Tasso Engelberg, Georg Gottesmann, Ernst Vulkan, Heinz Beer, Kurt Herzka, Kurt Weinwurm, Trude Schneider, Thea Gottesmann, Gerti Melzer und Shalom Berger.
Mit denen war ich sonntags auch auf dem Zentralfiedhof, am 4. Tor. Dort durften wir Ball spielen, picknicken und uns ohne Einschränkungen wie normale Jugendliche benehmen.
Mein Glück war, dass mein Vater in der Kultusgemeinde gearbeitet hat, denn dadurch waren wir irgendwie geschützt und wurden nicht nach Polen deportiert, sondern nach Theresienstadt. Viele, die in der Kultusgemeinde gearbeitet haben, sind 1942 nach Theresienstadt deportiert worden.
Wir wussten, dass es das Ghetto in Theresienstadt gibt, aber was sich dort abspielt, haben wir nicht gewusst. Gehört hatten wir über die KZs Dachau und Buchenwald, denn es gab Leute, die dort waren, gleich ab März 1938, und einige wurden mit einem Permit oder einem Affidavid entlassen. Dadurch haben wir etwas erfahren.
Ungefähr 100 000 Juden aus Österreich gelang die Flucht ins Ausland. Die Leute standen Schlange vor dem ehemaligen Palais Rothschild in der Prinz-Eugen-Straße, denn da hatte Eichmann von 1938 bis 1942 sein Büro, die ‚Zentralstelle für jüdische Auswanderung’ eingerichtet.
Dort saß die Gestapo. Wenn jemand auswandern wollte, musste er von dort einen Stempel haben, um überhaupt aus Österreich rauszukommen. Und man brauchte einen Pass, den viele Leute damals nicht besaßen. Da musste man sich bei der Polizei anstellen, um einen Pass zu bekommen.
Dann musste man zur Steuerbehörde, um eine Bestätigung zu bekommen, dass man keine Steuerschulden hat. Dann musste man eine Reichsfluchtsteuer bezahlen, sonst hat man keinen Stempel bekommen. Schikanen über Schikanen! Wenn man einen Pass bekommen hatte, lief man von einem Konsulat zum anderen, um ein Visum zu bekommen.
Man hat versucht als Butler, als Gärtner, als Hausmädchen nach England zu kommen. Nach Italien sind einige illegal geflüchtet, andere sind über Aachen nach Belgien geflüchtet und weiter nach Holland. Manche bekamen eine Einreise in die USA. Dann begannen Ende 1939 Kindertransporte nach England.
Es ging die ganze Zeit nur darum, irgendwie rauszukommen! Man hat alles Mögliche versucht. Es gab auch Kindertransporte nach Palästina, an die man mit einem Zertifikat oder auch mit Protektion kam. Es war sehr, sehr schrecklich.
Mein Vater hat alles versucht, um mich rauszubringen aus Österreich. Er hatte kein Glück. Er hat es nicht geschafft, mich irgendwo unterzubringen. Ich hatte keine Möglichkeit rauszukommen. Alexander Lauer, dem Sohn meiner Tante Hilda, der Schwester meiner Mutter, hat er helfen können, nach England zu flüchten. Alexander war ein Jahr älter als ich.
Die Familie war sehr fromm, und er kam in einem Transport der Agudat Jisra’el, das sind ganz Fromme, nach England, unter. Seine Mutter Hilda starb 1937 an Krebs, die Urne seines Vaters Naftali Lauer wurde uns 1942 aus dem KZ Buchenwald geschickt. 1939 war er verhaftet und nach Buchenwald deportiert worden. Wir mussten für die Urne bezahlen und haben ihn dann am Zentralfriedhof, am 4. Tor, begraben.
Wenn ich ehrlich bin, ich wollte auch nicht wegfahren. Ich wollte meine Eltern nicht allein lassen. Ich bin in dieser Zeit ziemlich schnell erwachsen geworden. Ich habe gesehen, was sich abspielt, und ich war damals auch sehr viel unter erwachsenen Menschen, sodass ich bald erfasst habe, was um mich herum passiert.
In den Wohnungen saßen die Leute zusammen und haben über alle möglichen Sachen diskutiert. In die Wohnung ist man gegangen, weil man Angst hatte, irgendwo anders zu sitzen. Die Kaffeehäuser waren verboten, die Kinos waren verboten, die Theater waren verboten, überall hat gestanden ‚Juden ist der Eintritt verboten’. Wir durften auch in keine Parkanlage mehr gehen, auf Bänken durften wir uns nicht mehr setzen, und mit der Straßenbahn durften wir auch nicht mehr fahren.
Ab 1940, als ich die Schule beendet hatte, musste ich mich auf dem Arbeitsamt melden, habe ein Arbeitsbuch bekommen, und dann musste ich in einer Fabrik auf der Rossauer Lände arbeiten, die für die Wehrmacht produzierte. Ich besitze das Arbeitsbuch noch heute. Das war eine chemische Fabrik.
Der Besitzer der Fabrik hieß Weinzierl. Und da habe ich mir eingebildet, der wird mir helfen, dass wir nicht deportiert werden. Aber der hätt’ mir nicht geholfen. Geholfen hat nur, dass mein Vater in der Kultusgemeinde gearbeitert hat. Das war unser Glück.
Es waren immer weniger Juden in Wien. Wien wurde Judenrein gemacht. Die Transporte gingen nach Lodz in Polen, Riga in Lettland, Kaunas in Litauen, Minsk in Weißrussland und Theresienstadt in der Tschechoslowakei und andere Orte, wo sie ermordet wurden. 45 000 Jüdinnen und Juden wurden innerhalb weniger Monate aus Wien deportiert.
Als wir wegmussten, waren nur noch wenige Juden in Wien. Die Übriggebliebenen waren Mischlinge und ein paar, die früher hohe Posten in der österreichischen Armee hatten, die haben sie nicht verschickt. Aber später haben sie die auch verschickt.
Wir sind am 24. September 1942 aus dem Sammellager in der Sperlgasse 2a, einer ehemaligen jüdischen Schule, auf offenen Lastautos, zu denen wir unter den Beschimpfungen der Leute hingeführt wurden, zum Aspang-Bahnhof gebracht worden. Wir wurden noch mit Tomaten beworfen und die Wiener riefen: raus mit euch Juden!
Das war die Zeit, als Deutschland die meisten Siege feierte. Frankreich hatten sie auch schon besetzt. Ich weiß noch, ich war sehr traurig über den Hass der Leute. Was mich erwartete, habe ich nicht gewusst. Ich wusste, ich will weg von Wien, und ich wusste, in Theresienstadt sind Juden. Dort sind Juden, was sein wird, wird sein.
Wir sind mit dem Zug zwei Tage gefahren. In diesem Transport aus Wien befanden sich ungefähr 1 300 Menschen.
Dann kamen wir in Bauschowitz an. Der Bahnhof lag drei Kilometer von Theresienstadt entfernt. Wir mussten zu Fuß mit unseren Sachen ins Ghetto gehen.
Theresienstadt ist eine Stadt, eine Festung, die während der Regierungszeit von Kaiser Joseph II ab 1780 erbaut wurde. Das war eine Garnisonsstadt, in der die Familien der Soldaten gelebt hatten. In der Festung gab es viele Kasernen.
Alles war umgeben mit zwei Mauern, dazwischen war ein Graben mit Wasser gefüllt. Die Mauern waren je acht bis zehn Meter dick und auch so hoch. Sie bestanden aus gebrannten Ziegeln. Das Ghetto wurde von tschechischer Gendarmerie bewacht unter der Obhut der SS und von Juden selbst verwaltet.
Als ich im Ghetto war, habe ich drei Lagerführer erlebt, alle drei waren Österreicher: SS- Hauptsturmführer Siegfried Seidl, SS-Obersturmführer Hauptsturmführer Anton Burger und SS-Obersturmführer Karl Rahm. Die SS-Leute hatten im Zentrum ein Büro, und außerhalb haben sie in einem Hotel, nach dem Krieg wurde es das Parkhotel, gewohnt.
Das Ghetto in Theresienstadt mussten tschechische Juden 1941 errichten. Und sie waren dort auch die Herren. Sie hatten dort die Macht. Sie hatten die guten Posten, wir waren die Neueinwanderer sozusagen, uns hat man auf die ärgsten Plätze geschickt.
Die meisten tschechischen Juden, nicht alle, aber ein großer Teil von denen, hat Deutsch gesprochen. Die anderen waren tschechische Patrioten, wollten nicht Deutsch sprechen. Auch mit uns wollten sie nicht Deutsch sprechen.
Als wir ankamen, haben die tschechischen Juden uns im Auftrag der SS erst einmal alles weggenommen, was wir noch besaßen. Jeder hatte 40 Kilo mitnehmen dürfen. Ich hatte einen Rucksack und einen Koffer. Da war eine große Schleuse, wo man die Sachen hingebracht hat. Sie haben das ausgepackt und für die Leute, die dort waren, verwendet.
Das Ghetto Theresienstadt wurde von tschechischen Juden verwaltet und von tschechischer Gendarmerie bewacht. Der Lagerführer, während ich im Lager war, war ein Österreicher, der SS- Hauptsturmführer Siegfried Seidl. Die SS-Leute hatten im Zentrum ein Büro, und außerhalb haben sie in einer Villa oder in einem Hotel gewohnt.
Sie sind jeden Tag mit dem Auto ins Büro gefahren. Die tschechischen Juden hatten Kontakt zu den Gendarmen. Es waren einige sehr anständige Gendarmen dabei, sie haben manchmal Nachrichten oder Sachen überbracht und haben geholfen.
Man hätte nicht ausbrechen können, die Gendarmerie hat aufgepasst. Die Tschechen hätten vielleicht eher geholfen als die Österreicher, aber sie hatten natürlich auch Angst. Die meisten SS – Männer dort waren Österreicher. SS-Männer waren vielleicht acht.
Zu dieser Zeit befanden sich zwischen vierzigtausend und fünfzigtausend Leute im Ghetto. Man brachte damals noch viele Menschen aus Österreich, aus Deutschland und später aus Holland, aus Westerbork. Viel später kamen die Juden aus der Slowakei. Aber die meisten waren aus Deutschland.
Als ich in Theresienstadt war, war der Judenälteste der Tscheche Jacob Edelstein23. Unser Wiener Lehrer Aron Menczer kannte Edelstein aus der Hitlerzeit, denn er war damals oft in Prag und hatte einen guten Kontakt zu ihm. Er kannte mehrere Leute aus Prag. Aron kam mit demselben Transport wie meine Eltern und ich und ungefähr zwanzig meiner Freunde aus Wien.
Dank Aron haben wir eine Gruppe mit zionistischen Jugendlichen gegründet. Wir haben auch durch ihn einen besseren Platz bekommen in Theresienstadt, wo wir zusammen gewohnt haben. Das hat alles der Aron für uns erledigt. Wir haben uns Betten gebaut, wir haben dort’n ein biss’l Kulturarbeit gemacht, man hat uns Hebräisch gelehrt, wir hatten Professoren, die Vorträge hielten, es gab Musiker, die Konzerte gaben, es gab Theateraufführungen, alles konnte man machen. Es gab sogar eine Synagoge.
Wir hatten viel Freizeit, die SS-Männer haben sich überhaupt nicht gekümmert.
Sie haben nur eines gemacht: Ab September, als wir nach Theresienstadt gebracht wurden, begannen die großen Transporte in den Osten. Es gab einen Zusammenhang zwischen diesen Transporten und der Offensive der Russen. Die Schlacht um Stalingrad hatte begonnen! Die Russen begannen sich dem Deutschen Reich zu nähern. Da haben sie angefangen, die Menschen auf die Transporte in die Vernichtungslager zu schicken.
Niemand hat gewusst, wohin die Transporte gehen. Wir haben nur gewusst, es geht nach dem Osten. Aber wohin die gehen, das wussten wir nicht. Es sind manchmal schreckliche Nachrichten durchgesickert, aber wir haben das nicht geglaubt. Dass wir vernichtet werden in Auschwitz haben wir nicht gewusst. Wir haben gedacht, dass wir in Arbeitslager kommen.
Aber viele wurden zum Beispiel nach Minsk gebracht, dort hat man sie auf der Straße erschossen. Es ist niemand zurück gekommen von denen. Aber wir haben nichts gewusst. Manchmal haben wir sogar Nachrichten, Postkarten, bekommen.
Man hat sich Codes ausgemacht. Wenn man das und das schreibt, bedeutet das das und das. Und deswegen hat man etwas vermutet über Dinge, die dort passieren. Aber Auschwitz? Die Wahrheit, was sich dort abspielt, haben wir nicht gewusst. Aber wir hatten Angst.
Zuerst haben wir zusammen gewohnt, das war auf einem Dachboden. Es war schrecklich. Wir haben nichts gehabt. Aber meine Mutter hat auch daraus was gemacht. Mein Vater hat dann in der Sudetenkaserne gewohnt, und meine Mutter hat einen anderen Platz mit anderen Frauen zusammen bekommen. Aber sie konnten sich jeden Tag treffen.
Ich hab durch Aron eine gute, aber schwere Arbeit in der Küche beim Essenstransport bekommen. Ich habe also Essen ausgeteilt. Das war schwer, aber ein großer Vorteil. Jeder hatte eine Essenskarte für den Tag, in der Früh gab es ein biss’l schwarzen Kaffee und ein Stück’l Brot, zu Mittag eine Suppe oder was anderes, und am Abend haben wir auch etwas bekommen.
In der Küche hatte ich Essen genug, so konnte ich meine Karte meinen Eltern zu ihren Karten dazu geben. Ich habe viel Essen gestohlen, Kartoffeln und alles Mögliche und habe alles meiner Mutter gebracht. Sie hat dann gekocht - wir haben nicht gehungert. Aber für die Leute, die nur ihre Essenskarte gehabt haben, war es sehr schwer.
Jeder hatte an seinem Gürtel einen großen Esslöffel. Wenn wir ein Fass ausgeschöpft hatten und das Fass noch dastand, sind die deutschen Juden gekommen mit ihren Löffeln und haben die Fässer ausgekratzt. So hungrig sind sie gewesen. Das war schrecklich!
Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass wir Jungen dort auf Kosten der Alten am Leben geblieben sind. Das, was wir gestohlen haben, haben wir ihnen gestohlen.
Es sind auch sehr viele Menschen in Theresienstadt an Hunger und Krankheiten, wie Typhus zum Beispiel, gestorben.
Viele konnten sich schwer an die schrecklichen Umstände anpassen. Zum Beispiel: die Betten waren Stockbetten, und da schliefen zwei unten und zwei oder drei oben. Die, die oben geschlafen haben, hatten es am besten, weil man sich oben etwas aufbauen konnte, zum Beispiel sich einen Tisch bauen. Und Verheiratete haben sich ab und zu oben getroffen. Es waren dort Situationen, die kann sich das nicht vorstellen.
Man konnte in Theresienstadt überleben. Aber trotz meiner guten Situation, bekam auch ich verschiedene Krankheiten, Typhus zum Beispiel. Es gab wunderbare Ärzte aus Prag. Meine Mutter hatte ein Myom [gutartiger Tumor], da wurde sie von einem Arzt, einem der größten Koryphäen aus Prag, operiert. Normalerweise wäre sie nie zu einem Arzt gekommen, der so hervorragend war.
Mein Vater hat beim Straßenbau gearbeitet. Ich habe ihm immer Essen gebracht. Mein Vater hat geraucht und sein Essen manchmal für ein paar Zigaretten verkauft. Meine Mutter war immer böse, wenn er Zigaretten gekauft hat. Aber was kann man machen?
Unsere Jugendgruppe hat sehr zusammengehalten. Von unserer Gruppe kamen vier junge Burschen vor uns mit einem Straftransport nach Auschwitz. Später habe ich erfahren, was mit ihnen passiert ist. Alle wurden in Birkenau ermordet.
Ich war bis September 1944 in Theresienstadt. Vierzehn Transporte sind weggefahren, Frauen, Männer, alle jungen Leute, unsere ganze Gruppe, die zusammen gewohnt hatte. Wir waren alle in demselben Transport nach Auschwitz. Mein Vater war auch dabei.
Was mit meiner Mutter war, habe ich nicht gewusst. Während der zwei Jahre, die ich in Theresienstadt war, waren die Schienen von den jüdischen Zwangsarbeitern von Bauschowitz nach Theresienstadt verlängert worden. Die Züge kamen direkt in die Stadt herein. Man hat uns von Theresienstadt nach Auschwitz geschickt.
Wir sollten am Jom Kippur, das war der 27. September, wegfahren. Aber die Lokomotive ist kaputt gegangen, da hat man uns gelassen. Ich erinnere mich noch heute, ich bin dann mit meinem Vater in die Synagoge gegangen. Wir haben gebetet, danach gefastet und am nächsten Tag mussten wir uns zum Transport melden.
Am 28. September mussten wir in die Waggons und dann, am Abend, sind wir weggefahren. Es wurde Nacht, und wir haben nicht gewusst, wohin wir fahren. Das waren Viehwaggons, in denen man nur so ein kleines Fenster hat. Wir haben beobachtet, wohin wir fahren, welche Richtung.
Anhand der Richtung haben wir gesehen, wohin wir fahren. Wir fuhren nach Osten. Ich erinnere mich, wir sind ziemlich langsam durch Dresden gefahren. Ich habe ein wenig von der Stadt gesehen. Wir sind durchgefahren und immer weiter, bis wir nach Schlesien kamen, durch Breslau fuhren und in die Nähe von Krakau kamen. Zwei Tage und eine Nacht sind wir gefahren.
Plötzlich, es war in der Nacht, hörten wir Schreie. Der Zug fuhr langsam durch ein Tor und blieb stehen. Die Waggontüren wurden aufgerissen, Häftlinge schrien: raus, raus, raus! Wir waren ungefähr tausend Menschen auf diesem Transport. Es war dunkel, aber ringsherum waren Lichter, Stacheldraht, Beton, Pfosten.
Auf dem Stacheldraht waren Schilder, auf denen stand: Hochspannung! Wir verstanden, dass alles mit Hochspannung geschützt war. Die meisten von den Häftlingen, die uns anschrien, waren polnische Juden. Meine Uhr haben sie mir sofort weggenommen: ‚Gib her die Uhr, die brauchst du sowieso nicht mehr.’ Alles, was ich damals noch besaß, haben sie mir weggenommen.
Nicht nur mir, allen haben sie alles weggenommen. Wir haben nicht gewusst, was uns geschieht. Wir wurden auf eine Rampe getrieben. Es roch komisch. Was riecht da? Irgendwas Verbranntes, wir wussten nicht, was das ist.
Auf der Rampe mussten wir uns in Fünferreihen aufstellen, der ganze Transport, die tausend Menschen in Fünferreihen. Vorn stand eine Gruppe von vier, fünf SS-Männern mit Hunden. An denen musste jeder vorbeigehen, und jeder wurde was gefragt. Ich habe gesehen, der SS-Mann zeigt auf die eine Seite und oder auf die andere Seite.
Die älteren Leute gingen auf die linke Seite, die jüngeren Leute auf die rechte Seite.
Man konnte glauben, die linke Seite war für die Leute, die für die leichtere Arbeit bestimmt sind, und die auf der rechten Seite, das sind die, die die schweren Arbeiten machen müssen.
Oft haben sich Leute älter gemacht, damit sie leichtere Arbeit bekommen, anstatt sich auf die rechte Seite zu stellen. Zum Beispiel der Vater von meinem Freund war Apotheker. Der SS-Mann hat gesagt: Was bist du von Beruf? Apotheker.
Brauchen wir nicht, linke Seite. Hätte er gesagt, er war nämlich noch jung, er sei Schlosser oder so was ähnliches, wäre er vielleicht am Leben geblieben. So war das.
Als ich dran war, hat mich ein SS-Mann gefragt, wie alt ich bin, was für einen Beruf ich habe. Elektriker, habe ich gesagt. Und ich musste auf die rechte Seite. Das waren die Fragen der SS-Leute. Wir haben nicht verstanden, was da überhaupt passiert.
Und da mache ich diesen Juden den Vorwurf, die mit uns als erste zusammengetroffen sind, als wir aus den Waggons mussten, dass sie uns nicht davor gewarnt haben, was dort passiert. Die anderen Häftlinge haben uns nicht geholfen, nichts gesagt, jeder war nur für sich. Die haben nicht gesagt:
hört zu, dort ist eine Selektion, macht’s euch jünger, sagt das oder das. Sie haben uns nicht gesagt was da passiert. Die wollten nur unseren Besitz: hast einen Goldring, hast eine Uhr - alles was sie wollten, haben sie uns weggenommen. Das war schrecklich!
Ich habe nicht gewusst, wo mein Vater ist. Ich hatte ihn aus den Augen verloren. Ein paar Stunden später habe ich das Krematorium und das Feuer gesehen. Wir begannen mit den anderen Häftlingen zu sprechen. Wir haben sie gefragt, wohin man die Leute gebracht hat, die von der Rampe weggeführt wurden?
Da hat einer zu mir gesagt: siehst du dort den Schornstein und den Rauch? Dort sind sie schon rausgeraucht. Ich war entsetzt! Aber ich habe es glauben müssen. Ich habe den Rauch gesehen mit meinen eignen Augen. Und ich habe es gerochen.
Die geblieben sind, hat man nachher in das KZ Birkenau gebracht, in das Zigeunerlager. Es standen dort viele große Baracken. Am ersten Tag wurden uns außer den Schuhen und dem Gürtel alle Kleider weggenommen. Und dann mussten wir duschen. Wir haben nicht gewusst, dass man dort, wo wir geduscht haben, unsere Eltern vergast worden waren. Diesmal ist statt Gas Wasser aus den Duschen gekommen.
Nach dem Duschen haben wir Sträflingskleider bekommen. Die waren sehr dünn, und zu der Zeit war es kalt in Polen, sehr, sehr kalt. Wir haben schrecklich gefroren.
Die Baracken waren früher Pferdeställe der polnischen Armee. In jeder Baracke war in der Mitte ein Kamin, und auf der Seite sind die Pferde gestanden. Dort hatte man statt der Pferde Stockbetten aufgestellt. Es gab einen Blockältesten, der war für alles verantwortlich. Das waren manchmal Kriminelle, Verbrecher.
Manches Mal hatte man Glück, dann war der Blockälteste ein Sozialist. Viele Kapos waren Verbrecher. Die haben uns auch nur alles wegnehmen wollen, was wir noch gehabt haben. Vom Essen haben sie uns nur ein wenig gegeben, das andere haben sie selbst genommen.
In der Früh mussten wir zum Appell antreten, wurden gezählt, am Abend mussten wir wieder antreten, wurden wieder gezählt und oft geschlagen.
Als wir in die Baracke gekommen sind, haben wir unsere Schuhe ausziehen müssen und zu je fünf Paar hintereinander aufstellen. In der Früh waren alle Schuhe weg, kein Schuh war mehr da. Man muss sich das mal vorstellen, es lag Schnee, und wir hatten keine Schuhe mehr.
Einer hat dem anderen die Schuh gestohlen. Ohne Schuhe, wenn man krank wurde, war man gleich erledigt. Birkenau war schrecklich! Ich hab sehr schnell begriffen, dass man dort nicht bleiben darf, das war kein Platz, um zu überleben. Häftlinge haben uns zu verstehen gegeben, dass man, um in Birkenau überhaupt zu überleben, eine eintätowierte Nummer haben muss.
Wenn du keine Nummer hast, warst du nichts wert. Du warst Freiwild, sie konnten mit dir machen, was sie wollten. Ich habe begriffen, dass ich rauskommen muss. Wenn man in Birkenau bleibt, ist man Futter für die Krematorien.
Die polnischen Juden haben Jiddisch gesprochen. Ich habe genau zugehört und verstanden, es werden SS-Männer kommen, die suchen Fachleute. Meine Freunde und ich haben zusammengehalten, und dann kam wirklich ein SS-Mann und suchte Schlosser. Wir haben uns alle gemeldet.
Das erste Mal wurden wir nicht genommen, aber beim zweiten Mal ist es uns gelungen. Wir waren sechs Freunde, und wir wurden alle für die Arbeit ausgesucht. Man hat uns bessere Kleidung gegeben, und wir bekamen eine Nummer in den Arm tätowiert. Das hieß, wir waren Menschen. Wir bekamen Decken, wurden zum Zug gebracht, und wir fuhren von Birkenau nach Gleiwitz [Gliwice, Polen]. Das war nach drei schrecklichen Wochen.
Meine Freunde Otto Kalwo, Heinz Beer, Kurt Herzka, Georg Gottesmann, Ernst Vulkan und ich blieben zusammen. Wir haben fest zusammengehalten. Damals war Gleiwitz eine deutsche Stadt, heute liegt Gleiwitz in Polen. Gleiwitz war eine große Stadt und lag ungefähr fünfzig Kilometer von Auschwitz entfernt. Dort gab es vier Nebenlager vom KZ Auschwitz.
Die Wachmannschaften in dem KZ waren aus Rumänien, deutschstämmige Siebenbürger. Die waren noch schlimmer als die Deutschen, schreckliche Leute waren das. Man hat uns in eine Fabrik, in der Eisenbahnwaggons repariert wurden, gebracht.
Ein riesiges Werk war das! In großen Hallen standen ungefähr zehn Waggons, einer hinter dem anderen. Vielleicht zwanzig Gleise gab es da. Die Waggons waren beschädigt, und wir mussten sie reparieren. Uns wurde gezeigt, was wir machen müssen. Wir haben die Nieten aufschneiden müssen. Mit Schweißapparaten haben wir das gemacht.
Es war eine wirklich schwere Arbeit den ganzen Tag. Ich war kein Schlosser, aber ich habe schnell gelernt. Kalt war es, das kann man sich nicht vorstellen. Jedes Eisenteil war sehr schwer und kalt. Wir haben in zwei Schichten gearbeitet, einmal am Tag und einmal in der Nacht.
Essen haben wir bekommen, und duschen konnten wir uns auch. Aber es war schwer, und es war nicht geheizt. Es waren viele Menschen in der Baracke, darum war es etwas wärmer. Jeder musste mal rausgehen, da musste man sich abmelden, dann wurde aufgepasst, dass man nicht wegläuft.
Sechs Tage in der Woche haben wir gearbeitet, und am siebenten Tag haben wir nicht gearbeitet. Und da haben Sie uns am siebenten Tag, damit wir beschäftigt sind, zum Appell antreten lassen. Wir mussten dann Steine, die auf einem Platz einen Kilometer vom Lager entfernt lagen, auf einen Platz ins Lager tragen und dann dieselben Steine zurücktragen. Nur damit wir nicht ausruhen können.
Während meiner Schweißarbeiten hatte ich aus Eisen so eine Art Topf hergestellt. Viele andere Häftlinge, die bei den Waggons gearbeitet haben, brachten mir deshalb ein paar Kartoffeln, Kraut und alles Mögliche, was sie in den Waggons gefunden hatten. Wir waren doch keine Tiere; Kartoffeln kann man doch nicht roh essen, wir mussten sie kochen.
Da haben sie mir die Kartoffeln gebracht, und ich hab mit dem Schweißapparat die Kartoffeln gekocht, und habe dann auch etwas abbekommen. Diese Essen haben mich ein biss’l über Wasser gehalten. In den Waggons haben wir auch manchmal ein paar Zeitungsausschnitte gefunden.
Da konnten wir gelesen, dass die Russen vor Warschau standen. Aber ganz genau haben wir das nicht gewusst… Und auf einmal bekamen wir den Befehl, wir gehen nicht zur Arbeit. Jeder bekam ein halbes Brot, eine Konserve mit Blutwurst, ein Stückchen Margarine und Marmelade. Blutwurst ist nicht koscher. Die darf man nicht essen.
Wir mussten losmarschieren. Das war ein Todesmarsch. SS-Männer haben uns die ganze Zeit begleitet. Das waren schon ältere Leute von der Waffen-SS, Soldaten, die nicht mehr an der Front eingesetzt wurden. Manche der Bewacher waren anständig, manche nicht. Es war sehr kalt, es war noch immer Winter.
Wir hatten keine warmen Kleider und schlechte Schuhe. Wir sind gegangen, gegangen, gegangen ... wohin? Das haben wir nicht gewusst. Wir gingen den ganzen Tag, viele Kilometer. Unterwegs konnten sehr viele nicht mehr. Diese Leute wurden einfach erschossen.
Wer zurückgeblieben ist wurde erschossen. Wir sind drei Tage zu Fuß gegangen. Essen haben wir nicht bekommen, in der Nacht hat man uns irgendwo in ein Lager gebracht, da sind wir vor Müdigkeit sofort eingeschlafen. Kalt war uns, einer ist auf dem anderen gelegen. So haben wir geschlafen, einer hat den anderen gewärmt.
Am Ende des Todesmarsches kamen wir nach Blechhammer [Blachownia Śląska, Polen]. In Blechhammer war ein riesengroßes Hydrierwerk, wo die Deutschen aus Kohle Benzin und künstliches Gummi erzeugt haben. Dort arbeiteten viele Kriegsgefangene. Aber es gab in Blechhammer auch ein großes KZ.
Das war ein Außenlager des KZ Auschwitz. In diesem Lager waren unter anderem Franzosen, Jugoslawen, amerikanische Piloten, Engländer, sogar aus Palästina war dort eine Gruppe britische Soldaten, die in Kreta in Gefangenschaft geraten waren. Einer der bekanntesten von denen war Josef Almogi, der spätere Führer der Histadrut 24 in Haifa.
Uns hat man ins KZ gebracht. Das heisst, man hat uns über Nacht hingebracht. Ich erinnere mich an einen großen Appellplatz und ungefähr zwanzig Baracken. Das war schon Anfang Februar 1945. Es war furchtbar kalt, ein sehr kalter Winter. Dort fand ich eine englische Armeeuniform, die ich anzog. Die Wolle der britischen Uniformen war unglaublich warm.
Man hat uns in eine Baracke gebracht, und das war unser Glück, in der Kisten mit Sodawasser-Flaschen standen. Wir hatten nicht allzu viel Platz. Meine Freunde aus Wien und ich waren zusammen geblieben. Die anderen sind in anderen Baracken untergekommen. Wir sind todmüde eingeschlafen. Und dann, in der Früh, hat es wieder geheißen: aufstehen und zum Appellplatz. Man musste sich immer anstellen um sich Abzählen zu lassen.
Wir haben unter uns ausgemacht, dass wir uns nicht auf dem Appellplatz aufstellen, denn wir hatten mitbekommen, was sich dort tut. Die Leute, die nicht gehen konnten, die müde waren, wurden erschossen. Warum sollten wir uns dort erschießen lassen? Wir gingen nicht aus unserer Baracke.
Ob man erschossen wird draußen oder hier, in der Baracke, da ist es besser hier. Warum sollten wir uns unterwegs noch plagen? Draußen wurde geschrien, raus, raus zum Appell. Wir sind nicht gegangen, wir haben uns nicht gemeldet, wir haben uns in der Baracke versteckt. Aber die SS-Männer haben gemerkt, dass sich viele Leute versteckt haben, dass sie nicht rausgehen. Was haben die gemacht? Sie haben begonnen, die Baracken anzuzünden.
Sie haben brennende Fackeln auf die Dächer geworfen, und die Baracken begannen zu brennen. Die Leute haben nicht atmen können und sind rausgelaufen. Wer rausgelaufen ist, wurde wie die Hasen abgeschossen. Wenn einer Glück gehabt hat, hat er bis zum Appellplatz geschafft.
Wenn nicht, ist er am Weg erschossen worden und liegengeblieben. Wir sind nicht rausgegangen. Unsere Baracke begann auch zu brennen. Die Sodawasser-Flaschen haben uns gerettet. Wir haben das Sodawasser auf das Feuer gegossen; die ganze Zeit, und wir haben überlebt.
Den ganzen Tag haben sie dort Leute erschossen, dann sind sie weg. Die haben scheinbar Angst bekommen. Die Leute, die sich am Appellplatz gemeldet haben, hat man, das habe ich später erfahren, zu Zügen am Bahnhof gebracht und sie in einem Waggon nach Groß-Rosen geschickt.
Es waren mit uns dann noch einige Leute, die sich, wie wir, im Lager versteckt hatten. Viele waren verletzt und sind daran gestorben, weil sie keine Hilfe hatten. Wir haben uns zwei Tage dort aufgehalten. Wir hatten nichts zu Essen, wir waren hungrig. Aber wir haben uns nicht rausgetraut, wir blieben in der Baracke. Draußen war es ruhig.
Dann, am dritten Tag, haben wir langsam die Tür aufgemacht und haben rausgeschaut. Wir konnten das Tor sehen, durch das wir reingegangen waren. Das Tor stand offen, und auf den Wachtürmen waren keine SS-Männer. Ich bin aus der Baracke rausgegangen, auch andere sind rausgegangen.
Da waren Leute, die schon längere Zeit in dem KZ waren. Sie haben gesagt, in welcher Baracke man was zu essen finden könne. Wir sind alle dort’n hingelaufen und haben die Baracke aufgebrochen. Es gab Brot, und ich habe soviel Brot genommen, wie ich tragen konnte.
Auf einmal, ich wollte mit dem Brot gerade aus der Baracke, stand draußen ein SS-Mann mit einer Maschinenpistole, der die Leute abknallte. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Es bildete sich ein Menschenhaufen. Alle lagen aufeinander, da hab ich mich einfach dazu geworfen.
Mit dem Brot habe ich mich raufgeworfen. Ich bin gelegen, und der hat geschossen. Auf einmal hat er aufgehört zu schießen. Er hatte keine Kugeln mehr, hat Angst bekommen, denn wir waren doch viele, er war nur einer. Daraufhin ist er weggelaufen. Langsam habe ich mich aus dem Menschenhaufen rausgegraben. Einige waren tot oder verletzt.
Ich habe das Brot genommen und es meinen Freunden gebracht. So hatten wir was zu essen. Es war ganz still. Meine Freunde und ich hatten nun Brot und Wasser. Nach ein paar Tagen waren der Otto Kalwo und ich schon ein biss’l bei Kräften, und wir wollten wissen, wo wir sind. Wir verließen das Lager. Die anderen, Heinz Beer, Kurt Herzka, Georg Gottesmann und Ernst Vulkan blieben in der Baracke. Sie waren zu schwach um mit uns zu kommen.
Das Lager war umgeben von einem ganz großen und dunklen Wald. Man hat kaum etwas gesehen, weil es so dunkel war. Wir gingen eine Strasse, die durch den Wald führte, entlang. Plötzlich hörten wir von weitem Motorengeräusch. Wir glaubten, die SS kommt zurück und sind in den Wald reingelaufen.
Wir kamen zu einer Anhöhe. Von der Straße aus konnte man uns nicht sehen, denn es war wirklich sehr dunkel. Wir sahen, dass sich ganz langsam eine Autokolonne näherte. Ich sagte zu meinem Freund: hör zu, diese Autos schauen nicht so aus wie die Autos von den Deutschen. Die sind etwas anders. Wir waren uns aber nicht sicher.
Die kamen immer näher, und wir sahen dann deutlich, das waren keine deutschen Autos. Das waren, später habe ich das erfahren, amerikanische Lastautos. Die russische Armee hatte diese Autos von den Amerikanern bekommen. Jetzt haben wir verstanden, denn wir haben gesehen, auf der Motorhaube war ein großer roter Stern; ein Sowjetstern.
Das waren Russen! Wir stellten uns mit erhobenen Händen auf die Straße. Das erste Auto blieb stehen. Ein Soldat mit Pelzmütze stieg aus. Das war das erste Mal, dass ich einen Russen gesehen habe. Er trug eine Pelzmütze mit einem Sowjetstern.
Ich habe gesehen, dass auch er Angst hatte. Ich wusste nicht, was ich sagen soll, da habe ich gesagt ‚Jid, ja. Jid, Jid’ (Jude, ja, Jude, Jude). Er schaute uns an und sagte: ‚Ja tosche Jid’ (ich bin auch Jude). Es hat sich herausgestellt, das war ein jüdischer Offizier, und der hat jiddisch gesprochen.
Viele der russischen Offiziere waren Juden, man konnte sie als Dolmetscher einsetzen. Also haben wir mit ihm reden können. Wir haben ihm gesagt, dass da ein Lager ist. Seine Kompanie hat dann das ganze Lager besetzt und übernommen. Die Russen waren sehr anständig, sie haben alle nach und nach rausgeführt und betreut.
Wir blieben noch zwei Tage dort. Wir bekamen Essen, und der Offizier sagte uns, dass nahe des Lagers eine kleine Siedlung sei. Dort hatten die deutschen Ingenieure, die in dem großen Werk in Blechhammer gearbeitet hatten, gewohnt. Der Ort war ungefähr einen Kilometer vom Lager entfernt.
Meine Freunde und ich gingen dorthin und haben uns einfach in eine Villa reingesetzt. Alles gab es da, denn die Deutschen hatten alles stehen gelassen und waren weggelaufen. Im Keller waren Lebensmittel gelagert: eingelegtes Fleisch, Gemüse und Obst, alles war da, nur Brot haben sie nicht gehabt, und es gab kein Wasser und kein Geschirr.
Wir sind von einem Haus zum anderen gegangen und haben uns Geschirr geholt. Das, was schmutzig war, haben wir rausgeworfen aus dem Fenster. Das war richtig wertvolles Porzellan, aber wir hatten keinen Bezug zu dem allen mehr. Wasser hatten wir, indem wir Schnee aufgetaut haben. Manche unserer Freunde haben Durchfall bekommen, das war gefährlich.
Wir blieben drei Wochen in dieser Villa. Hatten dort, wie man sagt, ein meschuggenes [hebr/jiddisch:verrücktes] Leben. Der Offizier kam uns wirklich öfter besuchen. Und eines Tages kam er zu uns und sagte: Freunde, ihr müsst’s von da weg gehen, ihr könnt’s nicht bleiben, weil wir Angst haben, dass die Deutschen eine Gegenoffensive starten, und ihr könntet wieder in ihre Hände geraten. Geht's in Richtung Osten, weiter nach Polen rein. Und wir gingen los: er war der Kommandant.
Wir luden alle möglichen Sachen, die wir hatten, auf ein Wagerl, und schleppten außerdem noch Sachen so mit. Einer von uns, der Georg Gottesmann, war krank. Er hatte die Ruhr. Wir haben ihn in einem Wagerl geschoben, weil er nicht gehen konnte. Das war alles sehr schwer, aber wir sind sehr viele Kilometer wieder zurück in Richtung Osten gegangen.
Teilweise sind wir gegangen, und teilweise konnten wir die Bahn benützten. Die Russen hatten die Schienen verbreitert, damit die russischen Lokomotiven darauf fahren konnten. Bis nach Posen haben sie die Schienen umgebaut. Wir haben schnell gelernt, wie man den Lokomotivführer fragt, wohin er fährt. Und da sind wir mitgefahren und teilweise zu Fuß gegangen.
In Oberschlesien waren noch Deutsche, in Gleiwitz zum Beispiel. Die hatten vor uns unheimliche Angst. Wir haben ihnen alles weggenommen, wir haben sie aus den Wohnungen rausgeschmissen, die sollten uns bedienen. Dann waren wir in Kattowitz, und danach sind wir mit einem Zug bis nach Krakau gekommen.
In Polen musste man alles mit Geld bezahlen, sie haben uns nichts umsonst gegeben. Man musste für alle Sachen bezahlen. Aber woher hätten wir Geld haben sollen? Wir haben einige Sachen verkauft: eine Jacke, einen Hut usw. Dafür haben wir Geld bekommen. In Krakau war dann ein jüdisches Komitee, das war in der Dluga Strasse Nummer 38.
Vom Komitee haben wir Ausweise vom Roten Kreuz bekommen, aber ansonsten haben sie uns nicht viel helfen können, sie haben selber nichts gehabt. Wir haben uns mit einigen Juden aus Polen befreundet. Die Russen waren sehr misstrauisch und die Polen auch, sie hätten denken können, wir sind deutsche Soldaten, die weggelaufen sind.
So haben wir immer Leute gehabt, die bezeugen konnten, dass wir Juden sind und uns dadurch geschützt haben. Wir haben nur ein paar Worte Polnisch verstanden, aber das war nicht genug, um sich zu verständigen. Wir blieben immer in der Nähe unserer neuen Freunde, damit sie für uns reden konnten. Eine Zeit lang blieben wir in Krakau.
Die russische Armee hatte so eine Art Sammellager eingerichtet, dort konnten wir schlafen und man hat uns zu essen gegeben. Wir hatten nichts mehr, alle unsere Sachen, auch unsere Kleidung, hatten wir verkauft. Essen und schlafen können war schon genug für uns, das war schon etwas! Aus dem Lager konnten wir die Stadt Krakau besichtigen, und wir waren das erste Mal nach dem Krieg im Kino.
Die Russen sind dann immer weiter vormarschiert, über die Oder, nach Deutschland hinein. Das war schon im März. Anfang April haben die Russen uns gesagt, dass sie ein Lager in der Nähe von Sagan [poln. Żagań], das ist nicht weit von der Oder, errichtet haben. Im Februar 1945 hatten sie diese Stadt in Niederschlesien, die zwischen Cottbus und Breslau liegt, eingenommen.
Wir wurden mit der Bahn nach Sagan gebracht. Dort war auch ein großes DP-artiges Lager25. Da waren schon Jugoslawen, Franzosen und Menschen aus allen möglichen Ländern. Dort konnten wir schlafen und essen. Wir hatten ja keine Kleidung, aber ein Freund war ein guter Schneider. Wir haben dort eine schöne Nähmaschine und Ballen von Stoff gefunden.
Aber unser Freund hatte nur eine Nadel für die Nähmaschine, und die eine Nadel ist zerbrochen, und so konnte er nicht nähen. Was haben wir gemacht? Wir sind in die Stadt gegangen, und haben in der ganzen Stadt eine Nadel für die Nähmaschine gesucht. Ich weiss nicht, was wir alles zerbrochen haben, um eine Nadel zu finden.
Aber zum Schluss haben wir eine gefunden. Nicht nur eine, wir haben ein ganzes Paket gefunden. Auch dort waren die Deutschen weggelaufen und hatten alles zurück gelassen: die Häuser, die Wohnungen, die Geschäfte, die Fabriken. Die Russen haben es ganz einfach gemacht: Wenn sie eine Fabrik gefunden haben, haben sie die Wände umgelegt und alles, auch die Maschinen, genommen.
Bei den Wohnungen haben sie einfach die Fenster herausgenommen. Sie haben alles genommen und nach Russland gebracht. Und das, was die Russen gemacht haben, haben wir auch gemacht. Wir haben alles genommen, was wir konnten.
Aus den Stoffballen hat unser Freund Unterhosen für uns genäht, wir hatten ja keine. Jeder hatte dann eine Menge Unterhosen. Und Leiberln hat er uns auch genäht von dem Stoff. Die Zeit ist vergangen, den ganzen April und den Mai waren in Sagan.
Dort gab es auch Zigeuner. Wir hatten nicht viel zu tun, und da haben wir uns von denen die Zukunft voraus sagen lassen. Ich erinnere mich noch genau, die Zigeunerin sagte zu mir: du hast eine Mutter! Ich sagte: ja, eine Mutter habe ich gehabt. Sie sagte: du hast eine Mutter! Sie sagte auch verschiedene andere Sachen, und noch zwei Freunden sagte sie: du hast eine Mutter. Wir haben das nicht geglaubt, wir wussten, das kann nicht sein.
- Nach dem Krieg
Die Zeit verging, es kam der 8. Mai, der Krieg war zu Ende. Die Russen kamen zu uns und sagten: der Krieg ist zu Ende, geht wohin ihr wollt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr seid frei, richtig frei!
Was haben wir uns gesagt? Wir sind nicht weit entfernt von Berlin, wir wollen nach Berlin fahren. Wir suchten uns einen Zug, der nach Berlin fährt. Was will der Zufall? Man brachte uns zu einer Bahn, die uns nach Cottbus fuhr. In Cottbus war ein schöner großer Bahnhof, die Russen hatten die Schienen mit der breiten Spur bis Cottbus gelegt. Die Züge sind nur bis Cottbus gefahren. Dort hatten sie erst begonnen, die Schienen bis Berlin zu legen.
Wir suchten nach einer Möglichkeit, nach Berlin zu kommen. Auf einmal sahen wir auf dem Bahnhof einen jungen Menschen mit einer Armbinde auf der stand ‚KZ Theresienstadt’. Meine Freunde und ich waren sicher, dass das KZ Theresienstadt aufgelöst worden war, dass sie alle mit den Zügen in die Vernichtungslager weggeschickt hatten.
Zu hundert Prozent waren wir sicher. Wir gingen zu dem jungen Mann und fragten: Theresienstadt, gibt es Menschen dort? Er erzählte uns, dass von allen möglichen Lagern viele Leute nach Theresienstadt gebracht worden waren. Es sind tausende Menschen in Theresienstadt. Als wir das hörten, haben wir uns gesagt, statt nach Berlin fahren wir nach Theresienstadt. Und das haben wir gemacht.
Wir sind dann von Cottbus mit einem Zug nach Dresden gefahren. Wir wollten von der Grenzstation Bodenbach nach Bauschowitz. Bauschowitz war die Bahnstation von Theresienstadt. Wir haben den Schaffner überzeugen können, uns ohne Geld mitzunehmen, denn Geld hatten wir ja keins. In Bauschowitz sind wir aus dem Zug gestiegen.
Als alte Theresienstädter kannten wir den Weg zu Fuß, das waren drei Kilometer. So waren wir damals aus Wien angekommen. Wir sind also von Bauschowitz zu Fuß die drei Kilometer nach Theresienstadt zur Festung rauf gegangen. Wir standen nicht unter Zwang, wir kamen freiwillig! Sigi Ritberg konnte noch nicht gehen, da haben wir das Wagerl gehabt, und wir haben ihn geschleppt.
Stop, die tschechische Gendarmerie wollte uns nicht reinlassen. Das Lager stand unter Quarantäne, im Lager war Typhus. Wir versuchten sie zu überzeugen, dass sie uns reinzulassen. Am Ende fanden wir einen Kompromiss: wir gehen rein, aber nicht mehr raus. Unter dieser Bedingung hat man uns reingelassen.
Wir kamen auf der Hauptstraße Thersenstadts rein. Dort traf ich einen älteren Herrn. Was will das Schicksal? Dieser ältere Herr war ein Freund meines Vaters. Er hatte mit ihm in der Kultusgemeinde zusammengearbeitet, und er war mit mir in Gleiwitz. Sein Beruf war Frisör. Frisör war ein guter Job, im KZ mussten wir immer geschnittene Haare haben. Ich hatte ihn in Gleiwitz gesehen. Er schaute mich an, ich schaute ihn an und sagte:
‚Wie kommst du daher?’
Er sagte:
‚Du lebst?’ Er erzählte kurz seine Geschichte: er war auch in Blechhammer, musste dann aber weiter nach Groß-Rosen. Von dort hatte man ihn dann ins KZ Buchenwald gebracht, und von Buchenwald ist er nach Theresienstadt gebracht worden. Ich hab ihm erzählt, dass wir in Polen waren, dass wir schon eine ganze Weltreise hinter uns hatten. Dann sagte er zu mir:
‚Du warst schon bei deiner Mutter?’
Ich schaute ihn an. Wo, wo ist meine Mutter? Er sagte, ich hab sie gesehen, sie ist hier! Ich sagte: das kann doch nicht sein? Du kannst mir glauben, ich habe deine Mutter hier in Theresienstadt gesehen. Er wusste nicht wo sie wohnt, aber er sagte, dass ich sie bestimmt finden werde, er hatte sie gesehen.
Ich wusste, wo ich mich erkundigen konnte. Ich habe gefragt, wo meine Mutter wohnt. Da hat man mir die Adresse gegeben, und sie hat wirklich da gewohnt. Sie wohnte auf einem Dachboden mit einer Freundin, einer Wienerin, mit deren Sohn ich befreundet war und der im Lager umgekommen war.
Ich weiß nicht, ob man sich vorstellen kann, wie das damals war. Ich bin auf den Dachboden gestiegen zu meiner Mutter, und sie sah mich. Kann man sich das vorstellen? Na gut, die erste Frage, die sie gefragt hat:
‚Wo ist der Papa?’ Ich konnte nichts sagen, und da hat sie nur gesagt:
‚Gott hat mir beschert, dass du am Leben geblieben bist.’ Sie hat dann gesagt, man hätte ihr erzählt, und sie wollte das nicht glauben, dass man mich in Krakau gesehen hatte.
Das war so:
Georg Gottesmann, einer unserer Freunde, war sehr krank geworden. Als wir nach Krakau kamen, hatte Georg Fieber. Wie sich herausstellte, hatte er eine schwere Tuberkulose. Da haben wir folgendes gemacht: Wir brachten ihn in ein Spital und sind dann weggelaufen. Am nächsten Tag sind wir ihn im Spital suchen gegangen. Dort, im Spital, traf ich einen Tschechen, der war ein Madrich in Theresienstadt. Er war auch Patient. Von ihm erfuhren wir, dass man unseren Freund im Spital aufgenommen hatte.
So war diese Nachricht zu meiner Mutter gekommen, aber sie konnte nicht glauben, dass ich am Leben war. Später ist unser Freund Georg nach Gauting, einem Vorort von München, verlegt worden.
Dort war ein Lungensanatorium. Und was wollte der Zufall? Wir erfuhren davon und haben ihn dann gleich besucht und ihm natürlich viel geholfen. Unser Freund im Spital hatte nichts, nur die Kleider, die er nach der Befreiung in Polen getragen hatte. Ich hab ihn mit Kleidung versorgt, das war damals für uns schon leicht. Alles, was möglich war, haben wir ihm besorgt.
Erfahren hat man damals alles durch Mundpropaganda, das ist sehr schnell gegangen und dann wurde auch alles in einer Lagerzeitung veröffentlicht. In Deggendorf haben wir eine Zeitung herausgegeben. Einer unserer Freunde war sogar ein Redakteur der Zeitung. So wussten wir sehr viel. So hat Georg auch die Nachricht bekommen, dass seine Mutter und seine Schwester den Krieg überlebt hatten.
Aber sie waren nicht in Wien, sie waren irgendwo in Ungarn.
Neben Georg lag ein älterer Herr. Die Frau dieses älteren Herrn war meine Cousine. Sie ist immer ihren Mann besuchen gekommen. Sie hat den Georg oft allein gesehen, da hat sie ihn gefragt, woher er kommt? Georg hat ihr seine ganze Geschichte erzählt.
Sie sagte ihm dann, sie habe einen Cousin in Wien gehabt, kenne ihn nicht, aber er müsste in Georgs Alter sein. Dann fragte sie ihn, ob er zufällig einen Leo Luster kenne. Was für eine Frage, sagte Georg, ich bin mit ihm aufgewachsen. Meine Cousine hat durch ihn meine Adresse in Deggendorf bekommen.
Sie war eine Tochter der Schwester meiner Mutter. Jahrelang hatten sie in Berlin gelebt, 1934 oder 1935 wurden sie als Polen aus Berlin nach Polen ausgewiesen. Ich kannte sie nicht, aber meine Mutter hat sie gekannt. Meine Cousine hat sich sehr gefreut, dass meine Mutter am Leben ist, denn sie waren die einzigen der Schwestern, die am Leben geblieben waren.
Die Freundin meiner Mutter, Frau Ehrlich, mit der sie in Theresienstadt am Dachboden gewohnt hat, hat mich dann gefragt: was mit ihrem Sohn Emil sei. Ich habe gesagt, dass ich es nicht wisse. Ich habe genau gewusst, dass er nicht mehr am Leben ist, aber ich habe es ihr nicht sagen können. Das hab ich nicht übers Herz gebracht.
Meine Mutter und ich haben dann eine Wohnung bekommen, und meine Mutter hat begonnen, mich zu versorgen. Sie war überglücklich, dass ich da war. Ich hatte inzwischen aber schon eine große Lebenserfahrung und viel miterlebt.
Zu der Zeit, als wir aus Theresienstadt nach Auschwitz gebracht worden waren, war Benjamin Murmelstein 26 der letzte Judenälteste im Ghetto Theresienstadt. Innerhalb der jüdischen Selbstverwaltung in Theresienstadt war er ab dem Moment der wichtigste Mann. Robert Prochnik, auch ein Wiener Jude, war sein Stellvertreter.
Als wir nach Ende des Krieges nach Theresienstadt kamen, war der Murmelstein nicht mehr da, aber Prochnik war da. Die Russen hatten einen Kommunisten als Lagerchef eingesetzt. Ein gewisser Vogel, glaube ich, war das. Der Prochnik hatte etwas Angst vor uns, denn viele Dinge, die damals in Theresienstadt gelaufen sind, sind bis heute schwierig einzuschätzen [Anm. nach Kriegsende wurde Robert Prochnik aufgrund seiner Tätigkeit für die Israelitische Kultusgemeinde - er war in Zusammenarbeit mit der ‚Zentralstelle für jüdische Auswanderung’ mit der Vorbereitung und Abfertigung der Deportationstransporte befasst - der Kollaboration beschuldigt.
Ein 1948 gegen ihn eingeleitetes Verfahren wurde bald eingestellt, 1954 wieder aufgenommen und 1955 endgültig eingestellt. Robert Prochnik starb 1977.Quelle: DÖW/Internet]. Jedenfalls hatte er Angst vor uns und hat uns wirklich bei vielen Dingen geholfen. Er hat uns eine Wohnung gegeben, in der wir wohnen und schlafen konnten. Essen hat uns nicht gefehlt.
Dann wurden Sudetendeutsche nach Theresienstadt gebracht, die putzen mussten. Wir haben auf sie aufpassen müssen. Ich habe sie ganz schön schikaniert, diese Deutschen. Die meisten Sudetendeutschen waren für Hitler, deshalb habe ich mich an ihnen gerächt.
In Krakau war ich mit ein paar österreichischen Kommunisten zusammen, die im KZ Auschwitz gewesen waren. Sie sind nach Wien zurückgefahren. In Wien wurde eine neue Regierung aufgestellt. Der Sozialdemokrat Karl Renner war ab 1945 bis zu seinem Tod 1950 Bundespräsident.
Ich wollte nicht zurück nach Österreich. Aber meine Mutter hatte vor unserer Deportation einer christlichen Frau eine schwere Goldkette mit einer Uhr und anderen Schmuck anvertraut und hoffte, die Uhr und den Schmuck zurück zu bekommen, da wir überhaupt nichts mehr besaßen.
Daraufhin beschlossen meine Freunde und ich, nach Wien zu fahren. Das war aber zu dieser Zeit fast unmöglich, weil man nicht einfach über die Grenze fahren konnte. Die einzige Möglichkeit, hatte man uns gesagt, sei mit dem Zug von Prag nach Bratislava zu fahren und von dort komme man vielleicht über die Pontonbrücke [auch Schiffbrücke oder Schwimmbrücke], die Russen hatten diese Brücke gebaut, nach Hainburg und von Hainburg nach Wien.
Wir sind dann wirklich nach Prag gefahren und von Prag nach Bratislava. Dort gingen wir zum jüdischen Komitee, Hilfe beim jüdischen Komitee zu erbitten, hatte ich in Krakau gelernt. Wir kamen zum jüdischen Komitee, und sagten: wir sind Wiener und wollen nach Wien, wie kommt man da hin?
Sie sagten, dass ein paar Russen unten bei der Brücke Wache stehen. Wenn man ihnen Wodka gibt, dann kann man rüberkommen. Sie haben Wodka für uns organisiert. Wir sind zu den Russen gegangen, haben ihnen den Wodka gegeben, und wir durften auf einem Lastwagen die Brücke passieren.
Die Brücke hat schrecklich gewackelt, und die Donau hatte eine ordentliche Strömung. Noch dazu, der meschiggene [jiddisch für verrückt] Soldat. Aber wir sind rübergekommen und waren in Österreich, in Hainburg.
Wir waren sechs, der Walter Fantl war der Einzige der Gruppe, der dann in Wien geblieben ist, Siegfried Ritberg, Heinz Beer, Oskar Weiss, Kurt Herzka und ich und zwei älterere Männer, die russisch gesprochen haben, einer, weil er in russischer Gefangenschaft im 1. Weltkrieg war. Die waren unser Dolmetscher.
Wir sind dann mit einem russischen Lastauto nach Wien getrampt, wie man so sagt.
Unser Chauffeur war ein biss’l besoffen und hinter uns fuhr ein russischer Offizier und der wollte an ihm vorfahren, er hat ihn aber nicht gelassen. Als es ihm gelungen ist vorzufahren, hat er sich die Nummer des Lastautos aufgeschrieben. Wir kamen nach Schwechat, und da war eine Straßensperre beim Zentralfriedhof.
Dort hat der Offizier unseren Chauffeur gleich rausgeholt aus dem Auto. Dabei hat er uns gesehen und festgestellt, dass wir keine Bewilligung für die russische Zone hatten. Wir haben gesagt, dass wir keine Bewilligung brauchen, denn wir kennen uns in Wien sehr gut aus. Die Straßensperre war vor dem 4. Tor des Wiener Zentralfriedhofs.
Wir gingen die Mauer vom Friedhof entlang, stiegen dann über die Mauer, und gingen über den Friedhof auf die andere Seite. Und schon waren wir in Wien. An den Schienen der Tramway wurde bereits gearbeitet, wir konnten in die Stadt fahren.
- Rückkehr nach Wien
Wien war schrecklich zerstört. Aber ich hatte ein angenehmes Gefühl dabei, dass man Wien zerstört hatte. Die Menschen sind herum gegangen, haben in den zerbombten Häusern Holz gesucht zum heizen, weil sie keine Kohlen hatten, Wasser haben sie von den Hydranten geholt. Nichts hat mehr funktioniert.
Am Deutschmeisterplatz war das Büro der Kultusgemeinde. Wir sind dorthin gegangen, und die Leute dort sagten, dass wir ihnen helfen könnten, die Kultusgemeinde wieder aufzubauen.
Ich bin dann zu der Familie der Frau gegangen, der meine Mutter den Schmuck anvertraut hatte. Und was haben die gesagt? Die Russen hätten ihnen alles weggenommen. Aber ich habe mir nichts daraus gemacht.
Dann bin ich in das Haus in der Schreygasse gegangen, in dem wir gewohnt hatten. Ich wusste, die Hausbesorgerin hatte ein doppeltes Spiel gespielt - einmal war sie für uns, einmal gegen uns. Aber mein Vater hatte ihr alle unsere Möbel gegeben. Wir durften doch nichts verkaufen. Er hatte ihr alles geschenkt. Ich wollte sie besuchen, vielleicht war sie noch am Leben und ging in das Haus.
Die sei nicht mehr da, die Hausbesorgerin, sagte der neue Hausbesorger. Und wer war der neue Hausbesorger? Es war der Kreisobmann der NSDAP 27. Er hatte mich immer zum Schneeschaufeln und zu anderen minderwertigen Arbeiten geholt.
Nun trug ich die britische Uniform, ohne hohe Rangabzeichen, denn ich besaß ja nur diese Uniform und keine keine eigenen Kleider, und es war doch kalt in Wien! Die Österreicher hatten Angst und großen Respekt vor den Uniformen der Alliierten. Ich kam sozusagen als englischer Soldat in das Haus, in dem ich bis zu meinem 14. Lebensjahr gewohnt hatte.
Inzwischen war ich natürlich älter geworden. Der Hausmeister hatte ein Fenster, durch das er sehen konnte, wer ins Haus reingeht. Ich habe ihn sofort erkannt, aber er mich nicht. Er schaute mich an und zitterte vor der Uniform.
‚Sie kennen mich nicht’ fragte ich ihn. ‚Ich bin der Luster.’
‚Ja, so, Sie leben noch!’ Durchs Fenster des Hausmeisters sah ich das Schlafzimmer meiner Eltern.
‚Sie wissen, wem das gehört’, fragte ich ihn? ‚Das hat meinem Vater gehört.’
‚Ihr Vater hat mir das alles geschenkt.’
‚Das stimmt doch gar nicht,’ sagte ich, ‚die Möbel haben Sie der Hausbesorgerin weggenommen, mein Vater hat sie der Frau Schlicksbir geschenkt, aber nicht Ihnen.’ Auf einmal kamen alle Leute aus dem Haus. Es hatte sich herumgesprochen, dass ein englischer Soldat im Haus ist. Dann ging ich in den 3. Stock zu dem Herrn, der uns die Wohnung weggenommen hatte. ‚Packen Sie Ihre Sachen, in zwei Stunden verlassen Sie die Wohnung. Sie ziehen in die Kellerwohnung.’
Ehrlich gesagt, ich wollte nicht dort, nicht in Wien, sein. In Krakau hatte ich einen russischen Jungen kennengelernt, der für den NKWD 28 gearbeitet hat. Grischa hat er geheißen, er sprach sehr gut Deutsch. Grischa wollte aus mir einen Kommunisten machen.
‚Komm nach Russland, du wirst studieren, du wirst alles haben!’
Was wollte der Zufall? Ich traf diesen Grischa in Wien. Er saß im Augarten, dort war das Büro des NKWD, dort habe ich ihn getroffen. Wir haben uns über das Wiedersehen sehr gefreut.
‚Kann ich dir helfen, fragte er mich?’ Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht in Wien bleiben werde. Dann habe ich ihm aber die Geschichte vom Hausbesorger und dem Mann, der uns aus unserer Wohnung getrieben hatte, erzählt.
‚Wenn du dich in meinem Namen revanchieren kannst, mach das.’
Was er gemacht hat, weiss ich nicht. Aber er wird etwas gemacht haben.
Ich wollte nicht länger in Wien bleiben, ich konnte mir das alles nicht mehr anschauen.
Die Rückreise nach Theresienstadt war auch sehr abenteuerlich. Zuerst fuhren wir mit einem gemieteten Auto über die Grenze bei Ludenburg. Das war auch illegal, denn die Grenzen waren alle gesperrt. Und dann haben wir es nach Prag geschafft und von Prag nach Theresienstadt. Meiner Mutter habe ich gesagt, dass Wien nichts für uns ist.
‚In Wien haben wir nichts mehr zu suchen. Was wir zurücklassen mussten, haben wir für immer verloren.’
Inzwischen hatten wir durchs Deutsche Rote Kreuz Kontakt zu meiner Schwester in Palästina. Prochnik ist dann zu uns gekommen und hat uns gesagt, es bestehe eine Möglichkeit, nach Palästina zu kommen. Er habe Kontakt aufgenommen mit dem Joint in Paris.
Man könne eine Gruppe aus Theresienstadt in die amerikanische Zone nach Bayern bringen, ob wir Interesse hätten. Ich war sofort damit einverstanden, denn ich wusste, dort’n, wo die Russen sind, kann man nicht auswandern. Das war unmöglich! Von Wien konnte man nicht auswandern, alles war gesperrt. Auswandern konnte man aus dem Gebiet, wo die Amerikaner waren. Das hatte ich schon bald erfahren.
Die Amerikaner haben sehr geholfen. Die Russen haben auch viel geholfen, aber sie hatten nicht die Möglichkeit, sie haben selbst nichts gehabt, sie waren selbst verhungert. Der Prochnik hat uns dann wirklich die Möglichkeit gegeben, nach Bayern auszureisen. So sind wir in das DP-Lager nach Deggendorf gebracht worden.
Der Transport ging über Pilsen mit der Bahn bis nach Deggendorf. Das ist nicht allzu weit entfernt. In Deggendorf war eine alte Kaserne der Wehrmacht. Dort hatte man das Lager errichtet. Ich besitze noch die Listen von allen Leuten, die nach Deggendorf kamen, viele ehemalige Wiener aus Theresienstadt und sehr viele Deutsche sind dabei.
- Deggendorf
In Deggendorf hatten wir eine sehr schöne Zeit, vier Jahre blieben wir dort. Ich habe begonnen zu arbeiten, am Anfang für die Hilfsorganisation UNRRA der United Nations Relief and Rehabilitation Administration, später übernahm die IRO [Internationale Flüchtlingsorganisation (engl. International Refugee Organization)] diese Arbeit und dann arbeitete ich für den Joint [JDC - volle Bezeichnung: American Jewish Joint Distribution Committee, Kurzform Joint, ist eine seit 1914 vor allem in Europa tätige Hilfsorganisation US-amerikanischer Juden für Juden].
Ich wohnte mit meiner Mutter zusammen in einem großen Zimmer in der Kaserne.
Wir haben schön gewohnt, ich hatte einen guten Job, ich hatte meine Mutter und ein paar Freunde. Es gab dort einen Motorpool. Mit den Autos der UNRRA haben wir alles transportiert, was die Leute im Lager brauchten. Und wir haben die Autos in ‚Schuss gehalten’. Später war ich dann noch verantwortlich für einen größeren Motorpool beim Joint in Straubing, noch später habe ich in München-Schleißheim gearbeitet für den Joint.
Ich hatte dann ein Auto, einen Jeep. Benzin bekam ich wie viel ich wollte und konnte herumgefahren in Deutschland. Damals war es noch nicht möglich nach Israel einzureisen. Der Staat Israel wurde erst 1948 gegründet, und man konnte erst 1949 legal einwandern. Mein Job war gut, und ich habe gut verdient.
Mit meiner Schwester und meinem Freund Harry Linser, der 1946 illegal nach Palästina eingereist war, später einen guten Posten bei EL AL innehatte, standen wir die ganze Zeit im Kontakt. Harry, der auch in Theresienstadt gewesen war, war ein großer Sportler.
Er hatte es geschafft, 1946 aus Wien illegal nach Palästina auszuwandern. Er lebt noch heute hier. Er schriebuns damals: eilt euch nicht, ihr braucht noch nicht kommen, ihr habt noch ein biss’l Zeit. Die meisten der Freunde, mit denen ich die ganze Zeit zusammen war, später auch die Freunde in Deggendorf, sind nach Amerika ausgewandert. Man konnte von Deggendorf leichter nach Amerika auswandern, als in andere Länder.
Georg Gottesmann, der nach Gauting gebracht worden war, damit er geheilt wird, ist dann, nachdem wir erfahren hatten, dass seine Mutter und seine Schwester überlebt hatten, von München über Salzburg nach Wien zurückgegangen. Aber er ist nicht in Wien geblieben. Er ist dann nach Amerika ausgewandert.
Dort hatte einen Verwandten, das war der Otto Preminger 29. Er war Regisseur des Films Exodus. Georg hat dann auch beim Film gearbeitet. 1953 war er in Tel Aviv und hat an der ersten Maccabiade [Anm.: jüdische Olympiade] teilgenommen.
Georgs Schwester Thea war eine Jugendfreundin von mir, auch noch in Theresienstadt. Sie war ein fesches Mädel, alle Buben sind ihr nachgelaufen. Ich bin noch heute mit ihr in Kontakt. Sie lebt in Amerika. Sie ist wie meine Schwester. Das ist das Schöne, alle Leute, die damals zusammen waren, sind wie Brüder und Schwestern.
Mein Freund Shalom Berger war ein hübscher Bursch, hat Ghetto und KZ überlebt, war mit mir in Deggendorf im DP-Lager, war ein sehr intelligenter Junge, hat in der Zeitungsredaktion gearbeitet, die wir herausgegeben haben, hat beim Joint gearbeitet und in Amerika noch ein Doktorat gemacht.
Dann hat er sich wegen einer Frau umgebracht. Das ist doch schrecklich! Wieso weiss ich das? Der Direktor der Universität hat meine Adresse bei ihm gefunden, weil ich mit Shalom korrespondiert hatte. Da hat er uns das geschrieben.
Im Mai 1948 wurde der Staat Israel ausgerufen. Natürlich war es damals ziemlich schwer, es war ja nichts da. Es war ein ganz armes Land. Die Engländer haben wenig zurückgelassen und hatten auch nicht allzu viel Geld investiert. Sie haben höchstens herausgeholt, was man hier rausholen kann. Die Engländer waren keine guten Kolonialherren.
- Israel
Meine Mutter und ich kamen aus Deutschland mit einem Schiff hierher. Wir sind nach Marseille mit der Bahn gefahren. Und in Marseille waren wir ein, zwei Wochen in einem kleinen Lager. Das war so ein Umschlaglager. Und von dort aus hat man uns zum Schiff gefahren. Wir sind mit einem israelischen Schiff unter einer israelischen Flagge gefahren.
Natürlich war das für uns das erste Mal, dass wir so ein Schiff gesehen haben, mit einer großen israelischen Flagge. Wir hatten sogar Kabinen, und wir haben Essen bekommen. Das war eine herrliche Reise! Das war wirklich eine wunderschöne Reise. Wir waren alle, das waren ungefähr 1 000 Menschen auf dem Schiff, sehr, sehr gespannt.
Die Reise hat ungefähr fünf Tage gedauert. In der letzten Nacht haben wir schon nicht mehr geschlafen. Wir haben getanzt: jeder wollte Haifa sehen, wenn es auftaucht. Um fünf Uhr in der Früh haben wir uns der Küste genähert. Von weitem haben wir die Lichter gesehen. Das war ein großer Augenblick, ein wunderbarer Anblick!
Wir sind langsam nähergekommen, und dann in die Bucht gefahren. Das Schiff fuhr zur Landestelle, und wir sind ausgestiegen.
Wir haben Haifa von unten gesehen, den Karmel, die schönen Häuser! Für uns war das etwas Unfassbares. Viele Häuser in Haifa sind im Bauhaus-Stil gebaut. Die Engländer hatten sehr viel in der Nähe vom Hafen, den sie gebaut hatten, investiert. Die ganze Hafengegend war voll von englischen Büros, welche mit den Schiffen zu tun gehabt hatten.
Als wir vom Hafen abgeholt wurden, haben wir Formulare ausfüllen müssen und jeder hat ein Einwanderungszertifikat bekommen. Und in diesem Augenblick war jeder, der das Zertifikat bekommen hatte, israelischer Staatsbürger. Dann hat man uns zu Autobussen gebracht, die sind unten gleich beim Hafen gestanden.
Das waren eine Menge Autobusse. Man brachte uns in das Einwanderungslager Sankt Lux. Unter diesem Namen war es bekannt. Das war früher ein ganz riesiges großes Camp der Britischen Armee. Nachdem die Briten abgezogen waren, haben die Israelis daraus ein Einwanderungscamp gemacht.
Es gab sehr viele Baracken, da konnte man leicht die Leute unterbringen. Später wurde es umbenannt in Sha'ar haAliya [Tor zur Alija (Einwanderung)]. Heute kann man davon nichts mehr erkennen, es existiert nicht mehr.
Jeder hat seine Baracke bekommen. Ich habe mit meiner Mutter zusammen gewohnt.
Aber ich wollte unbedingt zu meiner Schwester. Ich hatte ihre Adresse, und ich hatte englische Pfund von meinem Cousin, den ich in Deutschland kennengelernt hatte. Dem war es gelungen 1944 über Rumänien illegal nach Palästina einzuwandern. Er ist dann aber 1946 nach Deutschland zurückgefahren.
Er wollte damals Business machen. Das ging zu dieser Zeit hier sehr schlecht. Wir hatten uns in Deutschland getroffen. Er hatte schon Geld, hat uns auch immer mit Geld unterstützt, wenn wir welches gebraucht haben. Meine Schwester hatte nach Deutschland geschrieben, dass wir verschiedene Sachen mitbringen können. Wir haben einen Kühlschrank gebracht, und da mein Schwager Tischler war, haben wir Maschinen für seine Tischlerei gekauft. Wir durften alles zollfrei mitnehmen. Wir haben es in Deutschland aufgegeben und hierher geschickt.
Ich hatte Taschengeld und habe mir erklären lassen, wie ich nach Hadera komme. Ich bin dann aus dem Lager mit einem Sammeltaxi bis Hadera gefahren und hab dort die Adresse meiner Schwester gesucht. Es war damals sehr heiß, ich erinnere mich, es war der 6. Juli 1949. Sie wohnte sehr weit von der Hauptstrasse entfernt.
Das Haus war wie eine Baracke, ein halbes Haus. Es gab kein elektrisches Licht, die Toilette war außerhalb, Wasser auch. Man musste damals Eis kaufen für den Kühlschrank, und kochen musste man mit Petroleum, das war hier alles wirklich sehr, sehr primitiv.
Sie hat dort mit ihrem Mann und mit ihren zwei Töchtern gewohnt. Unsere erste Begegnung ist schwer zu beschreiben. Ich habe sie durch die Fotos, die sie uns nach dem Krieg nach Deggendorf geschickt hatte, sofort erkannt. Es war eine sehr große Freude, sehr berührend.
Sie hatte mich verlassen, da war ich noch ein kleiner Bub, gerade sechs Jahre alt. Und ich kam zu ihr als junger Mann, das ist schwer zu beschreiben.
Dann habe ich meinen Schwager kennengelernt, nur Bilder hatten wir gesehen. Er hat sehr, sehr schwer gearbeitet damals, sie mussten in Hadera beginnen mit gar nichts. Damals war eine schwere Zeit, Geld zu verdienen war sehr schwer. Aber mein Schwager hatte eine gute Arbeit gefunden.
Für die Neubauten hat man aus Holz das Gerüst gemacht, und dann hat man Ziegel draufgelegt für die Dächer. Das Gerippe war aus Holz. Damit hat er begonnen. In der Sonne auf den Dächern arbeiten war sehr schwer. Aber er war ein sehr fleißiger Mann. Nach zwei Tagen bin ich mit meiner Schwester nach Sankt Lux zu meiner Mutter gefahren.
Meine Schwester war sehr unzufrieden, dass wir dort wohnten. Und sie hat nicht weit von sich entfernt ein Zimmer mit einer kleinen Küchenecke für uns gemietet. Nach zwei Wochen sind wir übersiedelt. Jeder Neueinwanderer hat damals von der Jewish Agency ein Eisenbett, eine Decke, eine kleine, leichte Matratze und irgendein paar kleine Sachen bekommen.
Das Geld für diese Sachen musste man später zurückbezahlen. Das habe ich nicht gewusst. Wir haben unterschrieben, und man hat uns die Sachen gegeben. Das Eisenbett hat man am Anfang gebraucht, aber später hat man das alles nicht mehr gebraucht.
Meine Mutter und ich haben dann besser gewohnt als meine Schwester. Wir hatten Licht, die Toilette war drinnen und das Wasser auch. Als meine Mutter gesehen hat, wie meine Schwester wohnt, war sie ganz erschüttert. Wir kamen doch aus Europa. Das war so ein enormer Unterschied. Es war sehr schwer für sie zu begreifen, dass meine Schwester so arm leben musste.
Also hat meine Mutter immer gesagt, ihr müsst was machen, da könnt ihr nicht bleiben. Mein Schwager hat dann eine Anleihe aufgenommen, und er hat Boden gekauft, und dann hat er langsam begonnen, ein kleines Häuschen zu bauen. Ich hatte damals schon etwas Geld verdient, das hab ich ihnen gegeben.
In zwei oder drei Jahren hat er das Haus gebaut. Sie sind dann übersiedelt, bevor noch alles fertig war, es gab noch keinen Strom. Aber sie haben besser gewohnt, als vorher. Das Haus ist dann wirklich schön geworden, im Garten standen sogar Orangenbäume. Das Haus existiert noch heute, meine beiden Nichten Ruth und Pessy haben es geerbt.
Jeden Samstag bin ich mit meiner Mutter zu der Familie meiner Schwester gefahren.
Aber ich hab gesehen, Hadera, eine Stadt, die schon aus der Zeit von Rothschild war, war eine tote Stadt. Es gab kein Leben, es hat sich nichts verändert. Dort wollte ich nicht bleiben. Das war nichts für mich. Ich kannte eine junge Frau und ihre Freundin aus Theresienstadt, die meine Freunde und ich mit falschen Papieren nach Deggendorf geschmuggelt hatten. Sie waren Polinnen, aber sie haben auch Russisch gesprochen.
Sie hatten sich freiwillig zur Roten Armee gemeldet und unter General Shukow 30, in der Roten Armee als Krankenschwestern, gedient. Die eine hat dann beim Joint als Krankenschwester gearbeitet und einen polnisch jüdischen Zahnarzt, der in Frankreich studiert und gelebt hat, kennengelernt.
Ich hatte gehört, dass er nach dem Krieg in Frankreich bei der OSE [Obschtschestwo Sdrawoochranenija Jewrejew], einer jüdischen Hilfsorganisation, zu arbeiten begonnen hatte. Und ich hatte gehört, dass sie nach Israel eingewandert waren, denn diese OSE hat eine Zweigstelle hier in Israel aufgemacht.
Und ich hatte außerdem gehört, dass er mit einer fahrbaren Zahnklinik nach Israel gekommen war. Zu der Zeit haben sie jemanden gesucht, der mit dem Zahnarzt, Edek Fisher hat er geheißen, arbeiten wollte. Da ich in Deutschland beim Joint gearbeitet hatte, war ich ihnen bekannt, und sie haben mich dort gemocht und mich engagiert.
Also hab angefangen, bei denen zu arbeiten. Dieser Autobus kam mit einem Schiff. Alles war eingebaut, die Geräte, ein Generator und ein großen Tank für Wasser. Das heisst, man konnte arbeiten, wo man wollte. Wasser haben wir bekommen, das habe ich immer angefüllt, Benzin konnte man kaufen bei den Tankstellen, den Generator haben wir gehabt, und im Auto haben wir geschlafen. Wir hatten dort zwei Betten, eines über dem anderen. Wir sind von einer Stadt zur anderen gefahren.
Ich hab also begonnen, als Zahntechniker-Gehilfe zu arbeiten. Natürlich war das alles neu für mich. Ich hab gelernt, Plomben zu machen und habe dem Dr. Fisher sehr geholfen. Wir sind in Schulen gefahren und haben den Kindern die Zähne in Ordnung gebracht.
Wir sind in alle Gegenden gefahren, wo vorher die Araber gewohnt hatten, und nach dem Befreiungskrieg sich viele Immigranten niedergelassen hatten; zum Beispiel nach Ramlet oder nach Be'er Scheva. Dort entstanden natürlich auch Schulen. Das war ein riesiges Auto, und ich konnte gut Auto fahren, denn ich war ja viel in Deutschland gefahren.
Überall sind wir hingefahren und haben die Zähne jeden Kindes durchkontrolliert, und wer eine Plombe gebraucht hat, hat sie gleich bekommen. In Be'er Scheva, waren wir zum Beispiel eine ganze Woche. Ich war damals das erste Mal in Be'er Scheva. Alles war für mich neu. Be'er Scheva war damals eine Beduinenstadt. Dort waren drei oder vier Straßen und sechs Querstraßen.
Das war alles. Das war Be'er Scheva. Damals war Waffenstillstand. Man durfte nicht sehr nahe an die jordanische Grenze fahren, weil das noch gefährlich war. Es gab immer sehr viele Überfälle, auch in in Be'er Scheva. Man hatte uns gewarnt, wir mussten immer sehr vorsichtig sein. Heute ist Be'er Sheva eine Stadt von fast zweihundertfünfzigtausend Menschen.
Diese Hilfsorganisation hat dann begonnen, Heime für Mütter zu bauen. Die Mütter haben dort gelernt, wie man Kinder waschen muss, wie man sie erziehen muss. Und es entstanden Erholungsheime, auch diese Erholungsheime haben wir betreut. In einem dieser Heime habe ich meine Frau kennengelernt.
Sie hat dort als Pflegerin gearbeitet. Sie hat mir sofort gefallen. Später hatte sie dort’n einen anderen Job. Sie ist dann nach Ben Shemen gegangen, dort gab es eine Kinderrepublik, die Dr. Siegfried Lehmann in den 1930er Jahren gegründet hatte. Das Kinderdorf war für Waisenkinder und Kinder von Neueinwanderern.
Die meisten hatten keine Eltern mehr, die waren umgekommen, und die Kinder sind übriggeblieben. Für die Älteren gab es eine landwirtschaftliche Schule, Shimon Peres 31 wurde dort ausgebildet. Die Kinder und Jugendlichen haben wie im Kibbuz gelebt. Meine Frau war dort Erzieherin. Sie hatte eine Gruppe von Kindern auf die sie aufpassen musste. Dass die Kinder angezogen sind, dass sie alles bekommen, dass sie die Schulaufgaben machen.
- Meine Frau Schoshana
Meine Frau Shoshana, geborene Riesenberg, ist 1924 in Milnica geboren. Milnica gehörte bis 1918 zu Galizien, das zu Österreich-Ungarn gehörte und nach dem 1. Weltkrieg zu Polen. Ihr Vater war sehr früh gestorben. Nach dem Hitler-Stalinpakt 32 im August 1939 wurde Milnica den Russen zugesprochen.
Die Deutschen und die Russen haben sich damals Polen geteilt. Heute gehört die Stadt zur Ukraine.
Im Jahre 1939 war meine Frau 15 Jahre alt. Sie hat, als die Russen das Gebiet besetzt hatten in der Schule auch Russisch gelernt. Als der Überfall der Deutschen im Sommer 1941 auf die Sowjetunion begann, sind die die Russen geflüchtet und die Deutschen in Milnica einmarschiert. Zuerst gab es Massenerschießungen an Juden.
Die Übriggebliebenen wurden weiter östlich in ein riesengroßes Ghetto deportiert, wo sehr viele von ihnen an Hunger und Krankheiten starben. Shoshanas Mutter wurde von einer Familie versteckt. Die Deutschen haben sie gefunden, und man hat sie und die Leute, die sie versteckt hatten, umgebracht. Meine Frau und ihre Schwester Sonja waren in dem Ghetto.
Als die Deutschen begannen, das Getto zu liquidieren, sind meine Frau mit ihre Schwester in einen Wald gelaufen. Dort sind große Wälder. In dieser Gegend fanden sie bei einem Ukrainer, bei dem schon eine jüdische Familie versteckt, war, Unterschlupf. Der Ukrainer hat sich dafür bezahlen lassen, aber er hat sie nicht verraten und ihnen das Leben gerettet.
Als die Russen kamen, waren sie frei. Wenig später sind sie aus Polen mit einem Transport nach Deutschland in das DP-Lager Neu-Freimann in München. Freimann ist ein Stadtteil von München. Im Januar 1949 ist meine Frau nach Israel eingewandert, ihre Schwester und ihr Mann, den sie in Polen kennengelernt hatte, sind nach Kanada ausgewandert.
Meine Frau hatte noch einen Bruder. Zwi war, als die Deutschen kamen, mit den Russen nach Russland geflohen, hat in der Roten Armee gedient, dann in der polnischen Armee. Auch er hat den Krieg überlebt. Er ist nach dem Krieg illegal nach Israel eingewandert.
Zwi hat die größte polnische Auszeichnung von General Jaruzelski überreicht bekommen. Einmal war Shimon Peres in Polen bei General Jaruzelski, der ihn fragte, ob er Zwi kenne. Peres ließ Zwi dann über die Presse suchen. Zwi war, als er mit der Armee 1945 in Berlin war, sie einen kleinen Flugplatz erobert hatten, und die Deutschen eine Gegenoffensive starteten, der einzig Überlebende, der den Flughafen erfolgreich verteidigte.
Shoshana und ich haben 1955 geheiratet.
Ich hab also bei der OSE weitergearbeitet. Und dann hatte die OSE nicht mehr genügend Geld, und wir konnten nicht mehr mit dem Zahnarztwagen fahren. Ich habe mir einen anderen Job gesucht und fand einen bei Malben. Malben war die Hauptinstitution des Joint in Israel.
Es hat ein Netzwerk von Rehabilitationszentren, Krankenhäusern und Heimen für alte Menschen und behinderte Einwanderer aufgebaut. Dort arbeitete ich zehn Jahre. Im Jahre 1969 übergab der Joint alle Malben-Einrichtungen der Regierung und konzentrierte seine Bemühungen darauf, existierende soziale Dienste durch Zusammenarbeit mit der Regierung zu verbessern.
Ich begann in einem Spital nicht weit von Tel Aviv als ‚Mädchen für alles’ zu arbeiten. Das war ein Spital für chronisch Kranke und für ältere Leute. Ich war dort der Einkäufer für Gemüse und alles mögliche Andere. Ich hab den Job bekommen, weil der Direktor von Malben, der dort Personalchef war, ein Tscheche, ein gewisser Dr. Benesch, mit mir in Theresienstadt war. Er hat mich nicht gekannt, aber er hat es gewusst.
Die Wohnung meiner Mutter in Hadera hatte nur ein Zimmer. Ab 1953, damals war Golda Meir 33 Arbeitsministerin, hat man in Israel begonnen, Genossenschaftswohnungen zu bauen. Man brauchte nur verhältnismäßig wenig einzuzahlen, um zu so einer Wohnung zu kommen. Das habe ich gemacht.
Im Lager in Deggendorf hatte ein Mann gelebt, Schlomo Stendel hieß er, der eine Art Kibbuz an der Donau aufgebaut hatte. Dort hatte man begonnen, junge Juden als Matrosen auszubilden. Er war der Leiter dieser Jugendlichen. Später ist er nach Israel ausgewandert. Ich hatte ihn aus den Augen verloren.
Er war dann in Israel verantwortlich für die Registrierung dieser Genossenschaftswohnungen. Ich bin zu ihm gekommen, hat er mich gesehen, und durch ihn war ich einer der ersten, die so eine Wohnung bekommen haben. Das ist Eigentum, aber das war sehr billig. Wir haben, glaube ich, zweihundert Pfund bezahlen müssen. Damals gab es noch Pfunde und die Hypothek waren tausendsechshundert auf zwanzig Jahre. Es war eine wunderbare Wohnung.
1956 unsere Tochter Nava in Kfar Saba zur Welt gekommen, 1959 wurde unser Sohn Moshe in Jaffa geboren.
Wir haben acht oder neun Jahre da gewohnt, zum Teil mit meiner Mutter zusammen. Dann habe ich wieder beim Joint gearbeitet, da, konnte ich die Hypothek zurück zahlen. Zu dieser Zeit begannen auch die Restitutionszahlungen aus Deutschland und für viele Menschen in Israel wurde dadurch das Leben etwas leichter.
Bevor wir hier eingezogen sind, habe ich meiner Mutter eine eigene Wohnung in Givatayim gekauft. Ich habe für sie, nachdem mein Vater umgekommen war, einen Antrag auf Zahlungen aus Deutschland gestellt, und meiner Mutter wurde dieser Antrag von den Deutschen bewilligt. Und schon von den ersten Zahlungen haben wir ihr einen Kühlschrank gekauft. Ein Kühlschrank war eines der wichtigsten Sachen. Man hat diese Kühlschränke hier produziert, aber man musste sie mit Dollar bezahlen.
Die Atmosphäre im Land war, trotz der Armut und der vielen Probleme, gut. Wir hatten viele Freunde. Das war ein komisches Land: die Eltern haben von den Kindern die Sprache gelernt, nicht umgekehrt. Ich hab erst begonnen Hebräisch von meinen Kindern zu lernen. Meine Frau hat gut Hebräisch gesprochen.
Sie hatte schon in der Schule Hebräischunterricht, also konnte sie dolmetschen. Ich konnte mich ein biss’l verständigen, aber Hebräisch sprechen konnte ich nicht. Und da, wo wir gewohnt haben, haben auch viele Leute, ehemalige Juden aus Deutschland und aus Österreich, gewohnt.
Wir haben uns immer getroffen, und wir haben uns unterhalten, alle Feste haben wir zusammen gefeiert und Ausflüge gemacht. Das war wirklich eine richtig große Familie. Die ganze Umgebung! Das war sehr schön. Wir waren nicht reich, aber wir haben alles gehabt.
Zum Beispiel jeden Freitag haben wir uns getroffen, jeder hat etwas zu essen mitgebracht. Es gab noch nicht genügend Lebensmittel. Gemüse und Obst gab es viel, Brot war spottbillig, aber richtige Sachen hat es nicht gegeben. Und am Anfang war viel rationiert. Zucker und Öl waren rationiert. Später, 1953 hat das schon aufgehört.
Ich habe auch Leute wieder getroffen, von denen ich nicht gewusst hatte, dass sie überlebt haben. Einmal, bei einer Autobusfahrt, sehe ich, dass der Chauffeur eine Nummer am Arm hat. Ich schaute ihn an und sagte zu ihm:
‚Wir sind doch schon mal nebeneinander gestanden.’ Er schaute mich an:
,Was machst du da?'
Wir waren wirklich beide zusammen in Polen. Wir haben uns getroffen, er hat nämlich, glaub ich, 50 Nummern mehr gehabt als ich. Sein Name ist Refisch. Luster und Refisch standen im KZ 50 Nummern voneinander entfernt. Es hat sich dann herausgestellt, dass er auch in Givatayim wohnt, so wie ich. Wir haben uns oft getroffen - noch heute bin ich mit ihm in Kontakt. Seit langer Zeit lebt er in England. So war das, Leute haben sich wiedergefunden.
Aber was ich auch sagen will, zu Beginn haben sich die Sabres, also die Leute, die hier geboren waren, uns gegenüber nicht schön benommen. In ihren Augen waren wir Feiglinge; ‚Warum habt ihr euch nicht verteidigt? Ihr seid wie die Schafe zur Schlachtbank gegangen.’ Das haben sie nicht verstehen können.
Deswegen hatten wir auch wenig Kontakt mit den Sabres. Sie haben auf uns herabgeschaut. Unsere Geschichten haben sie überhaupt nicht interessiert. Das wollten sie gar nicht wissen. Sie haben gesagt, ihr seid wie die die Schafe gegangen, ihr seid Feiglinge.
Was wirklich passiert war, haben sie nicht begriffen. Erst 1961, während des Eichmann-Prozesses, haben sie begonnen, uns zu verstehen. Da ist der große Umschwung gekommen, da haben sie angefangen, sich wirklich zu interessieren.
An einem Tag hatte ich Gelegenheit beim Eichmann-Prozess dabei zu sein.
Es war sehr schwer, Karten zu bekommen. Der Prozess fand im Volkshaus in Jerusalem statt. Das erste, was mich unheimlich beeindruckt hat, es wurde im Radio übertragen, war die Anklagerede von Gideon Hausner, dem Staatsanwalt.
Er hat eine Stimme gehabt, da hat man eine Gänsehaut bekommen. Wie er gestanden ist und gesagt hat:
‚ich klage Sie an und spreche hier im Namen von sechs Millionen Juden.’ Ich hab das sogar auf Band aufgenommen.
Es gibt viele, die erzählen, sie wären Eichmann vor der Vernichtung der Juden persönlich begegnet. Das glaube ich nicht. Niemand ist an ihn rangekommen Keiner hat ihn persönlich gesehen, man kennt halt sein Gesicht. Von der Wiener Kultusgemeinde stand der Murmelstein mit dem Eichmann in Verbindung und der Löwenherz 34.
Sie hatten die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Und ich weiß, dass unser Aron Menczer mit ihm gesprochen hat. Zuerst ging es ja um Vertreibung der Juden und um den Diebstahl all ihren Besitzes. Dann ging es um Mord. Ich habe ihn an diesem einen Tages während des Prozesses gut sehen können, der Saal war nicht allzu groß.
Er saß in der Kabine, man hatte Angst, dass ihn jemand erschießen wird. Ein deutscher Anwalt hat ihn verteidigt. Aber es hat ihm nicht geholfen. Der einzige Mensch, der hier in Israel aufgehängt worden ist, ist der Eichmann, man hat seine Asche nachher über das Meer verstreut.
Meine Mutter hat dann von ihrem Bruder Jaques aus Amerika, der 1914 aus Galizien ausgewandert war, Briefe bekommen. Er wollte sie sehen und hat ihr ein Flugticket gekauft. Aber sie brauchte einen Pass, und den Pass konnte sie erst bekommen, wenn ich die Kaution für die Eisenbetten, die uns zu Beginn unseres Lebens in Israel zur Verfügung gestellt worden waren, bezahlt habe.
Ich hatte ja damals einen Wechsel unterschrieben. Nachdem ich alles bezahlt hatte, bekam sie einen Pass. 1956 ist dann meine Mutter nach Amerika geflogen. Ihr Bruder lebte in Brooklyn und arbeitete als Kellner. Damals, als wir noch in Wien waren, hat er uns wirklich nicht helfen können, Onkel Benjamin und seine Familie hat er retten können, aber für alle hat es eben nicht gereicht.
Leider haben sich meine Mutter und ihr Bruder nicht sehr gut verstanden, sie hatten sich nicht mehr allzu viel zu sagen. Aber sie hatten sich noch einmal gesehen. Nach einigen Wochen in Amerika kam meine Mutter zurück.
Meine Mutter konnte sich überall zu Recht finden, auch in Israel. Sie war nach ihrem Besuch bei ihrem Bruder in New York zufrieden, wieder zu Hause zu sein. Später war ich mit meiner Mutter noch einmal in Europa, ich glaube, das war 1958.
Wir sind mit dem Schiff nach Triest gefahren, und dann mit der Bahn nach Wien. In Wien haben wir eine Bekannte besucht, mit der hat meine Mutter korrespondiert hat. Sie hatte meine Mutter eingeladen. Sie war eine ehemalige Nachbarin, eine Jüdin, die verheiratet war mit einem Nicht-Juden.
Dadurch konnte sie in Wien überleben. Meine Mutter hat bei ihr gewohnt. Das war im 2. Bezirk, in der Franz-Hochedlinger-Gasse. Ihr Mann war Schneider. Sie war Kommunistin, eine sehr starke Kommunistin. Früher hatten wir immer über Politik diskutiert.
Meine Mutter hat sich in Wien aber nicht besonders gut gefühlt. Wir sind auch zu unserer alten Wohnung gegangen. Wir waren auch auf dem Friedhof, meine Mutter hat dort ihre Mutter besucht. Nach kurzer Zeit hatten wir genug und sind zu meinem Cousin Bernhard Westreich nach Brüssel gefahren. Mein Cousin war Diamanthändler. Er hatte den Krieg versteckt mit falschen Papieren in Budapest überlebt. Seine Eltern sind in einem Ghetto nahe Brzesko, wo sie gelebt hatten, umgekommen.
Die Zeit mit ihm war eine herrliche Zeit. Er hat uns dort die schönsten Plätze gezeigt, wir haben die besten Sachen gegessen, das war eine einmalige Sache. Wir waren vielleicht zwei Monate in Belgien, dann sind wir wieder zurück nach Hause gefahren - zurück nach Israel. Bernhards Frau und seine drei Kinder, ein Sohn und zwei Töchter leben in Belgien. Bernhard starb, ich glaube im Jahr 2008.
Ich glaube, Ende der 1950er Jahre habe ich dann eine Reise mit meiner Frau nach Amerika gemacht. Wir sind mit dem Schiff von Haifa bis nach Amerika gefahren. Bis nach New York. Das war eine der schönsten Reisen, die ich nie vergessen werde. Die Reise dauerte 20 Tage, das Schiff war die ‚Shalom’.
Einer meiner Freunde war Manager in New York von El Al, bei dem haben wir gewohnt. Ich habe dort alle meine ehemaligen Freunde, die nach dem Krieg nach Wien gegangen und von Wien nach Amerika ausgewandert waren, wieder getroffen. Wir waren dort einen Monat und hatten eine sehr, sehr schöne Zeit mit den Freunden.
Dann sind wir mit dem Autobus zu der Schwester meiner Frau nach Kanada, nach Toronto, gefahren. In Toronto hatten sie und ihr Mann ein Lebensmittelgeschäft, indem sie gearbeitet hat. Als ihr Mann starb, ist sie uns öfters in Israel besuchen gekommen.
Dann habe ich meinen Job verloren, weil das Gesundheitsministerium sich entwickelt und die Spitäler übernommen hat. Das waren dann alles Regierungsspitäler. Der Joint wollte diese Aufgabe sowieso loswerden. Die Regierung hatte dann ihre eigenen Leute.
Meine Mutter starb 1980 in Petach Tikva. Sie wurde 88 Jahre alt. Die letzten zwei Jahre ihres Lebens verbrachte sie in einem Elternheim in Ramat Gan.
Ich hatte meine österreichische Staatsbürgerschaft behalten. In der österreichischen Botschaft in Tel Aviv arbeitete ein Mann, dessen Vater einer der Gründer der Hakoah war. Sein Partner war ein sehr weit entfernter Verwandter meines Onkels, der in Amerika gestorben war. Die Botschaft suchte damals gerade einen Chauffeur. Ich habe einen guten Eindruck auf sie gemacht und bekam diesen Posten. Das war ein wirklich guter Job. Ich hatte sehr gute Beziehungen mit allen österreichischen Botschaftern.
Da ich ein Holocaustopfer bin, hatten sie Respekt vor mir. Ich durfte sogar die österreichische Politik kritisieren. Die Botschafter und Botschaftssekretäre und Sekretärinnen haben hier gern gelebt, denn wenn man eine Zeit lang hier lebt, wirkt sich das stark aus. Sie waren hier sehr zufrieden. Und ich war auch sehr oft in Wien. Als ich bei der Botschaft gearbeitet habe, sind meine Frau und ich oft nach Wien gereist. Wir waren auch in Deutschland, und wir waren zusammen in Theresienstadt.
Durch die Arbeit in der Botschaft habe ich viel gesehen. Zum Beispiel 1967 während des Sechstagekrieges. Da war ich mit dem Auto in der Jerusalemer Altstadt, gleich wie die Armee hineingegangen ist. Und dann war ich auf den Golanhöhen, als die Israelis die Golanhöhen erobert haben.
Einmal, in den 1980er Jahren, sind wir nach Wien gefahren und von Wien zu meinem Cousin nach Brüssel gereist und dann mit meinem Cousin von Brüssel mit dem Auto nach Polen. Mein Cousin war in Krakau geboren und dort in die Schule gegangen. Er hat uns Krakau gezeigt. Wir haben in einem Hotel gewohnt und hatten Tag und Nacht Angst.
Angst vor den Polen und Angst vor den Kommunisten. Zu dieser Zeit, als wir Polen besuchten, regierten dort die Kommunisten. Mit meinem Cousin sind wir dann nach Auschwitz gefahren. Damals war ich das erste Mal nach dem Krieg in Auschwitz. Das war für uns sehr schwer. Er war das erste Mal in Auschwitz.
Er selber war nicht in Auschwitz, aber sein Vater war dort ermordet worden. Mein Cousin hatte am Auto eine Brüssler Nummer, ich eine Wiener Nummer. Und ich hatte einen Diplomatenpass durch meine Arbeit. Aber damals gab es noch keine diplomatischen Beziehungen zwischen Polen und Israel. Erst ab Februar 1990.
Für mich war Auschwitz eine schwere Sache. Und meine Frau konnte sich eine Woche lang darüber nicht beruhigen, was sie in Auschwitz und Birkenau gesehen hatte. Es war schrecklich! Überhaupt fühlten wir uns in Polen nicht gut, wir waren sehr unsicher dort.
Meiner Tochter und meinem Sohn habe ich sehr spät über meine Vergangenheit erzählt. Bevor meine Kinder zum Militär gegangen sind, habe ich sie nach Wien gebracht. Ich wollte ihnen zeigen, wo ich hergekommen bin, wo einmal mein zu Hause war. Und da habe ich auch begonnen ihnen über mich zu erzählen.
Ich habe ihnen die Plätze gezeigt, wo die Verfolgungen stattgefunden haben. Auch meine KZ-Geschichte habe ich erzählt, aber nicht so gründlich. So richtig habe ich dann begonnen zu erzählen, als meine Enkelkinder größer geworden sind, als sie 14 Jahre alt waren, und wie viele israelische Kinder mit ihren Schulklassen nach Polen, nach Auschwitz, gefahren sind.
Nachdem ich sehr oft in Wien war, haben wir immer versucht, eine große nicht zu übersehende Gedenktafel für die zehntausenden Juden, die aus Österreich vom Aspangbahnhof im dritten Bezirk nach dem Osten deportiert worden sind, zu initiieren. Nachdem es dort fast nichts gibt, nur einem ganz unscheinbaren Gedenkstein.
Das hat mich immer sehr verdrossen. Bis zum heutigen Tag ist nichts passiert. Ich habe mit vielen Politikern darüber gesprochen, auch dem jetzigen Bundeskanzler Faymann und dem Stadtrat für Kultur und Wissenschaft Mailath-Pokorny habe ich anlässlich einer Zusammenkunft in der Residenz des österreichischen Botschafters in Tel Aviv gesagt, dass sie sich schämen sollen. Ich würde ein Mahnmal am Aspangbahnhof gern noch erleben.
Als meine Kinder jung waren, war Reisen für Israelis sehr teuer. Wenn man keine Verwandten hatte, bei denen man wohnen konnte, hat man sich das nicht leisten können. Ich konnte deshalb mit den Kindern reisen, weil ich einen Teil meines Gehalts auf ein Konto in Wien bekam. So waren sie recht früh in Europa, das war schon sehr schön, denn dadurch hat sich ihr Horizont sehr erweitert.
Meine Tochter Nava ist an vielen Dingen interessiert. Sie hat in Givatayim Architektur studiert. Sie mag aber die deutsche Sprache nicht und fühlt sich verständlicherweise in Österreich nicht sehr wohl. Meine Tochter ist mit Izchak Kedar verheiratet. Sein ursprünglicher Name ist Koronia, wie König. Seine Eltern stammen aus Istanbul.
Sie sind Nachfahren der Juden aus Spanien. Ihre Vorfahren, Urgroßeltern oder Ururgroßeltern waren aus Spanien in die Türkei geflüchtet. Weil mein Schwiegersohn bei der Polizei gearbeitet hat, musste er seinen Namen hebräisieren. Er hatte an seiner Uniform zwei Sterne. Die Sterne nennt man hier Falafel [Anm.: frittierte Bällchen aus Kichererbsen und Gewürzen]. Er war Oberst, jetzt ist er bereits in Pension.
Mein Sohn hat viele Jahre in Australien gelebt. Aber ich wollte nicht, dass er dort bleibt und meine Frau und ich haben ihn zurück geholt. Er ist nicht froh darüber, aber er ist da, und das ist wichtig. Mein Sohn hatte viele Freundinnen, hat aber nie geheiratet. Auch Kinder hat er keine. Jetzt ist er fünfzig. Aber vielleicht kommt noch mal die Richtige. Beruflich macht er Filme.
Nachdem ich aufgehört hatte zu arbeiten, habe ich mir eine Beschäftigung suchen müssen. Das war 1992. Ich habe mich mit Gideon Eckhaus verbunden, einem ehemaligen Wiener, der 1938, als 15 Jähriger, ganz allein nach Palästina geflüchtet war. Seine Mutter starb vor dem Holocaust, sein Bruder überlebte in den USA, sein Vater wurde in Auschwitz ermordet.
Er ist der Vorsitzende des Zentralkomitees der österreichischen Juden hier in Israel. Das Zentralkomitee beschäftigt sich mit Restitutionen, Pensionen und Staatsbürgerschaften für ehemalige österreichische Juden und deren Nachkommen. 1992 haben wir begonnen mit Österreich zu verhandeln, damit die Leute zu ihrem Recht kommen. In der Zwischenzeit ist viel passiert.
hat man den Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus gegründet und da hat Österreich den Vertrag unterzeichnet, 210 Millionen Dollar für das entwendete jüdische Vermögen zu bezahlen [Österreich sicherte im "Washingtoner Abkommen" zu, 210 Mio. US-Dollar für Opfer des Nationalsozialismus bereitzustellen und richtete zu diesem Zweck den Allgemeinen Entschädigungsfonds ein.
Dieser Fonds hat seit Aufnahme seiner Tätigkeit fast 21.000 Anträge mit rund 120.000 einzelnen Forderungen im Gesamtausmaß von 1,5 Mrd. $ bearbeitet.
Mittlerweile ist die Arbeit des Fonds fast abgeschlossen. 96 % der Fondsmittel sind ausgezahlt, Betroffene erhielten in der Regel zwischen 10 und 20 % der geltend gemachten Ansprüche. Anm.: aus dem Internet]. Außerdem hat der damalige österreichische Bundeskanzler Schüssel zugesichert, dass Österreich zum Beispiel Pflegegeld und Pensionszeitenanrechnung für vertriebene Juden aus Österreich, die jetzt in Israel leben, zahlen wird.
Da hatten und haben wir sehr viele Leute hier, die davon betroffen sind. Wir helfen diesen Leuten, dass sie zu ihren Pensionen kommen. Heute können in Österreich auch Kinder von Juden, die nicht in Österreich, sondern auf Mauritius, in Amerika oder in Israel geboren sind, einreichen und günstig Pensionen durch Nachzahlungen einkaufen.
Wir sind ein Komitee, bestehend aus zehn Leuten, das sich regelmäßig trifft. Unser Büro befindet sich in Tel Aviv, in der Levy Jitzchak Straße. Dieses Büro ist unser Eigentum, das hat Österreich finanziert. Im Büro arbeiten auch eine Sekretärin und eine Buchhalterin. Wenn Leute sterben, kommen andere und machen die Arbeit weiter.
Jeden Tag bin ich mehrere Stunden im Büro, freiwillig, wir nehmen kein Gehalt. Wir sind ein registrierter Verein, schreiben regelmäßig Berichte über unsere Arbeit und geben eine Zeitung heraus. Wir beraten gemeinsam, wir unterschreiben gemeinsam.
Wir werden finanziell von Österreich unterstützt und sind in guter Verbindung mit der österreichischen Botschaft in Tel Aviv. Ich habe natürlich besonders gute Verbindungen durch meine lange Arbeit bei der Botschaft. Ich kenne auch den jetzigen Botschafter. Wir sind sehr, sehr gut miteinander. Einer hilft dem anderen, und wir unterstützen uns gegenseitig.
Wir haben sehr vielen Leuten geholfen, die Leute sind sehr, sehr dankbar. Sie mussten sich Arbeitsjahre nachkaufen, damit sie ungefähr hundertachtzig Monate zusammen haben. Aufgrund der hundertachtzig Monate können sie nachher eine Pension bekommen. Die Pension ist nicht groß, es handelt sich vielleicht um eine Summe zwischen drei-, vierhundert Euro monatlich.
Aber was gut und wichtig ist: Sie haben eine Möglichkeit, wenn sie Gott behüte krank werden und hilfsbedürftig sind, einen Pflegezuschuss zu bekommen. Ich brauche oft die Hilfe aus dem Matrikelamt der israelitischen Kultusgemeinde in Wien. Und die bekomme ich. Da sucht mir der Herr Eckstein aus den alten Dokumenten viele Informationen heraus, und da kann ich den Leuten Auskunft geben.
Sie wollen wissen, wohin wurden ihre Verwandten deportiert, wo sind ihre Verwandten gestorben, wo sind sie begraben. Oder ich brauche Geburtsscheine. Früher war dort’n die Frau Weiss.
Da musste ich immer nach Wien selber fahren, um mir die Informationen zu holen. Jetzt ist mir leichter, jetzt rufe ich mehrere Male in der Woche an, und der Herr Eckstein kümmert sich sofort um alles. Heute, zum Beispiel, hab ich angerufen, eine Stunde später hatte ich schon die Geburtsscheine. Er sucht sofort und schickt mir alles per Email.
- Die politische Lage in Israel
Ich bin der Meinung, dass die Grundlage für Israels Aufbau die Kibbuzim 34 geschaffen haben, die Kibbuzniks, sie waren die Pioniere. Das waren Sozialisten, das war die sozialistische Partei, die Mapai, die Arbeiterpartei. Bis 1973 haben sie die Mehrheit gehabt.
Und dann haben sie die Wahlen verloren. Jede Partei, die zu lange an der Macht ist, wird unbeliebt. Die Leute, die zu lange an der Macht sind, werden korrupt. Es darf nicht nur eine Partei regieren. Man muss immer tauschen. In unserem Land herrscht Demokratie, das ist wirklich sehr gut.
Die Mapai hat damals die Wahlen verloren, dann ist Menachem Begin 35 an die Macht gekommen. Begin war der größte Feind vom Ben Gurion 36, denn Begin war Revisionist und gehörte zur Jabotinsky-Partei 37. Die meisten Anhänger vom Begin waren sephardische Juden. In Israel leben sehr viele sephardische Juden.
Sie haben eine große Kultur gehabt in Marokko, in Ägypten, in der Türkei, überall. Aber sie bildeten keine Führungsschicht. Viele von den Sephardim sind abergläubisch, sind sehr fromm, sie glauben noch an alle möglichen Sachen, welche wir, die aus europäischen Ländern kommen, schon abgelegt haben.
Das größte Problem hat Israel mit den Palästinensern. Sie sagen, wir hätten sie von hier vertrieben. Das stimmt zum Teil. Aber ich denke, so ist das nun mal in der Welt. Zum Beispiel: sehr viele Deutsche haben in der Tschechoslowakei, im Sudetenland, gelebt.
Die wollten auch, nachdem die Tschechen sie nach dem 2. Weltkrieg zu Recht und zu Unrecht vertrieben hatten, zurückgekommen in ihre Heimat. Hat man denen was zurückgegeben? Nein! Nicht nur eine, sehr viele Generationen hatten bereits dort gelebt.
Die Palästinenser wollen nach Ramlet zurück, sie wollen nach Tel Aviv zurück und nach Jaffa. 1948, als sie hier weggelaufen sind, waren es nach heutigen Schätzungen 450 000 Araber. Heute sind sie zwei Millionen. Ihren Kindern haben sie eingeredet, sie seien hier geboren und das sei hier ihr zuhause.
Sie glauben, dass sie hierher kommen und sich alles nehmen können. Das wurde ihnen die ganzen Jahre lang eingetrichtert. Wir sind fünf Millionen Juden. Um uns herum sind Milliarden Araber. Wir können nur dagegen setzen, weil wir stark sind. Weil wir uns von hier nicht vertreiben lassen.
Es gibt ein Gebiet, das nennt man Wadi Ara. Wadi nennt man einen ausgetrockneten Flusslauf. Dieses Gebiet befindet sich auf dem Weg nach Afula, einer Stadt in der Jesreel Zone im Norden Israels. Es gibt von Tel Aviv aus einen schönen Weg dorthin durch die Berge, durch den Karmel.
Dort war so eine Armut, dass man sich das heute kaum noch vorstellen kann. Die Araber haben dort gelebt wie vor hundert Jahren. Wenn man heute dort durchfährt, sieht man schöne Häuser, und überall gibt es richtige Strassen. Es gibt keinen Unterschied zwischen dort und zwischen dem restlichen Israel.
Es gab den Vorschlag, dass diese Araber zu den Palästinensern gehen, und wir werden die Gebiete austauschen. Das wollten sie unter keinen Umständen. Sie wollen nicht unter palästinensischer Herrschaft leben.
Die Araber in Jerusalem, die immer in der Altstadt gewohnt haben, die bekommen von Israel die Social Security. So etwas gibt es bei den Arabern nicht. Wenn einer alt ist, kann er in ein Altersheim, die Eltern bekommen für ihre Kinder Kindergeld, sie haben eine Krankenkasse, das haben sie alles in Israel bekommen.
Während des Befreiungskrieges 1948 verloren wir das jüdische Viertel der Altstadt in Jerusalem und den Osten der Stadt an Jordanien. Jerusalem blieb deshalb bis 1967 in das israelische Westjerusalem und das jordanische Ostjerusalem geteilt.
Die Juden waren vertrieben worden, das jüdische Viertel in der Altstadt zerstört, und der Zugang zur Klagemauer, dem heiligsten Ort des Judentums, blieb Juden fortan versperrt. Sie haben sogar geschossen, sie haben niemanden hingelassen. 1967, während des Sechstagekrieges, eroberten die israelischen Truppen das Gebiet zurück. Erstmals seit der Staatsgründung konnten Juden an der Klagemauer beten.
Aber Israel verweigerte den Muslimen nicht den Zugang zu ihren heiligen Stätten, sondern unterstellte den Tempelberg einer autonomen muslimischen Verwaltung. Das war vor 43 Jahren.
In der arabischen Altstadt von Jerusalem sieht man, dass Araber da leben und in der jüdischen Altstadt sieht man, dass Juden da leben. Man kann sich in der arabischen Altstadt frei bewegen, in die Geschäfte gehen, ohne irgendeine Angst zu haben. Die Altstadt hat nie so schön ausgesehen wie jetzt. Es gibt in der arabischen Altstadt ein österreichisches Hospiz.
Dieses Hospiz neben der Via Dolorosa wurde 1863 eröffnet. Kaiser Franz Joseph hat damals das Heilige Land besucht, als er zur Eröffnung des Suezkanals gefahren ist. Zur damaligen Zeit war Österreich eine Weltmacht. Damals haben sie fast Europa beherrscht.
Der Kaiser ist mit dem Schiff angekommen und dann mit dem Schiff zur Eröffnung des Suezkanals weiter gefahren. In Jaffa gab es zu dieser Zeit noch keinen Hafen. Da musste das Schiff draussen vor Anker gehen, und mit kleinen Booten wurden die Passagiere zum Hafen gebracht.
Da gibt's eine Geschichte dazu, die habe ich gelesen. Es war ein Sturm, und ein Araber ist mit seinem Boot losgefahren und hat den Kaiser nach Jaffa gebracht. Nachher hat ein Jude für ihn einen Brief an den Kaiser geschrieben, da hat der Araber eine lebenslängliche Rente bekommen.
Der Kaiser ist dann mit einer Kutsche bis nach Jerusalem gefahren, wo je ein Vertreter aller Religionen, die dort gelebt haben, ihm die Ehre erwiesen haben. Die Moslems haben ihm dort in die Moschee geführt, und die Christen haben ihn in die Grabeskirche geführt. In der Grabeskirche gibt es eine extra Abteilung der österreichischen Katholiken. Ein jüdischer Rabbiner lud den Kaiser in eine große Synagoge. Und nachdem die Zeremonie beendet war, fragte der Kaiser den Rabbiner:
‚Warum hat diese Synagoge kein Dach?’ Die Synagoge war damals noch im Bau. Der Rabbiner antwortete:
‚Zu Ehren Eurer Hochwürden haben wir unseren Hut abgenommen’. Daraufhin hat der Kaiser Geld gespendet, damit die Synagoge fertig gebaut werden konnte.
In Jerusalem gab es für alle Nationen, die hier lebten, ein Konsulat. Da hat’s ein französisches Konsulat gegeben, ein deutsches Konsulat gegeben und auch ein österreichisches Konsulat. Das österreichische Konsulat war etwas Besonderes. Alle standen unter dem Schutz von Kaiser Franz Joseph. Der Kaiser ist sehr verehrt worden von den Juden. Bis zum heutigen Tag.
Der Kaiser hat dann auch in Bethlehem eine Kirche gespendet, da wurde immer die Mitternachtsmesse gelesen. Dann gibt es in Jerusalem die 1910 geweihte römisch-katholische Dormitio-Kirche, die ist von den Benediktinern, nach den Plänen eines deutschen Architekten aus Köln, entstanden.
Da gibt es unten im Keller einen großen Altar, dort ist die sogenannte Mutter Gottes eingeschlafen. Und in einer Seitenkapelle ist für dem ermordeten österreichischen Bundeskanzlers Engelbert Dollfuß 38 ein Altar als Erinnerung entstanden.
Als ich ins Land gekommen bin, hat es sehr viele arme Juden gegeben. Auf dem Rothschild Boulevard lagen viele arme Leute schlafend auf den Bänken. Auch heute gibt es wieder arme Leute. Es ist hier nicht anders als in anderen Ländern, auch in Österreich gibt es viele arme Menschen. Es ist hier genauso wie in Österreich, das System ist dasselbe.
Die Orthodoxen leben wie in einem Ghetto unter sich. Sie wollen auch unter sich bleiben. Sie haben eine eigene Partei, die sie wählen können. Wenn die Partei viele Stimmen hat, bekommen sie Sitze in der Knesset [isr. Parlament]. Dort kann man reden.
Und sie haben viele Abgeordnete dort, sie haben sehr viele Leute. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass Israel mal ein religiöses Land werden wird. So weit wird es nicht kommen. Die Religiösen mischen sich leider in die Politik ein. Das ist nicht gut; Religion ist Religion. Und Politik ist Politik.
Die Chassidim 39 leben in einem Teil von Jerusalem. Diese Religiösen gibt es auch in Wien. Sie sind antizionistisch, demonstrieren gegen uns Säkulare, aber Geld nehmen sie für ihre Kinder. Und sie schreien gegen die Regierung. Aber das ist Demokratie, jeder kann seine Meinung äußern. Dagegen kann man nichts machen. Aber ich glaube, das geht zu weit.
Im Moment sind die Beziehungen vieler Staaten zu Israel schlecht. Zum Beispiel die Beziehung mit der Türkei. Das ist schrecklich. Lange Zeit, seit dem Atatürk 40, war die Türkei antireligiös. Jetzt, auf einmal, sind sie ganz religiös. Genau so wie die Iraner. Wir hatten zurzeit des Schahs gute Beziehungen und gute Handelbeziehungen. zueinander. Genauso die Syrier. Sie reden sich ein, sie werden uns besiegen. Wir haben ringsherum hier nur Feinde. Damit zu leben ist schwer.
Ich hab viel gesehen, hatte viele Bekannte, war oft in Wien. Als man hier das Parlament, die Knesset, eröffnet hat, da wurden alle Parlamentspräsidenten der europäischen Länder eingeladen.
Da kam auch der damalige österreichische Parlamentspräsident, ein gewisser [Alfred, ÖVP, Anm.] Maletta. Ich war immer neben ihm, er hat mich nicht von der Hand gelassen, denn er hat kein Wort Englisch gekonnt. Er war damals nicht der Einzige, der kein Englisch konnte. Der Handelsminister Otto Mitterer hat auch kein Wort Englisch können. Zum Botschafter sagte er damals:
‚geben Sie mir den Luster, ich nehme ihn zu mir nach Wien mit, er wird bei mir im Büro arbeiten.’ Der Botschafter sagte:
‚den überzeugen sie nicht, der geht nicht nach Wien, der geht von hier nicht weg.’ So war es auch, ich wäre nie aus Israel weggegangen.
Anm.: Herr Leo Luster erhielt 1984 für seine Arbeit in der österreichischen Botschaft die Silberne Medaille für Verdienste um die Republik Österreich verliehen, 2002 als Mitglied des Vorstandes in der Vereinigung Österreichischer Pensionisten in Israel und des Zentralkomitees österreichischer Juden in Israel das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich verliehen.
- Glossar
1 Jeshiva: eine Talmudhochschule, an der sich männliche Schüler dem Tora-Studium, und insbesondere dem Talmud-Studium widmen
2 Sheitl [Scheitel]: Die von orthodox-jüdischen Frauen getragene Perücke.
3 Affidavit: Im anglo-amerikanischen Recht eine schriftliche eidesstattliche Erklärung zur Untermauerung einer Tatsachenbehauptung. Die Einwanderungsbehörden der USA verlangen die Beibringung von Affidavits, durch die sich Verwandte oder Bekannte verpflichten, notfalls für den Unterhalt des Immigranten aufzukommen.
4 Schadchen: jidd.: Heiratsvermittler, Brautwerber
5 Schidach: Vermittlung
6 Cheder [hebr:Zimmer]: die Bezeichnung für die traditionellen Schulen, wie sie bis Beginn des 20. Jahrhunderts im osteuropäischen Schtetl üblich waren.
Der Unterricht fand im Haus des Lehrers statt, der von der jüdischen Gemeinde bzw. einer Gruppe von Eltern finanziert wurde, und war in der Regel nur Jungen zugänglich. Der Unterricht fand in kleinen Gruppen mit Jungen verschiedener Altersgruppen statt.
7 Chumasch: Buch mit den fünf Büchern Mose
8 Schammes: [hebr. Schamasch = Diener]: Synagogendiener. Er erfüllt die unterste Funktion in einer Synagoge. Daher wird der Begriff allgemein abwertend als ‚Laufbursche‘ gebraucht. Als Schammes wird auch für die Kerze bezeichnet, die zum Anzünden der übrigen Kerzen der Chanukkia [Chanukkaleuchter] verwendet wird.
9 Bar Mitzwa: [od. Bar Mizwa; aramäisch: Sohn des Gebots], ist die Bezeichnung einerseits für den religionsmündigen jüdischen Jugendlichen, andererseits für den Tag, an dem er diese Religionsmündigkeit erwirbt, und die oft damit verbundene Feier. Bei diesem Ritus wird der Junge in die Gemeinde aufgenommen.
10 JUAL-Schule: Zwischen 1938 und 1942 war die Schule in der Marc Aurel Straße 5 der einzige Ort, wo jüdische Kinder keine Angst vor Verfolgung haben mussten und sich geborgen fühlen konnten. Die jungen Chawerim [Freunde] wurden dort in jüdischer Geschichte, Religion und in praktischen Dingen unterrichtet und auf die Auswanderung nach Erez Israel vorbereitet.
11 Jüdische Künstlerspiele: Von 1927 bis 1938 war der Nestroyhof [Hamakom] die Heimat der Jüdischen Künstlerspiele. Unter der Leitung von Jakob Goldfließ präsentierten die Jüdischen Künstlerspiele Abende, die Zionismus, jüdische Identität und Antisemitismus thematisieren.
Der Spielplan war breit gefächert, sowohl jiddische Revuen mit zionistischer Tendenz von Abisch Meisels als auch anspruchsvolle Dramen wie Arnold Zweig.
Außer ansässigen Schauspielern wie Mina Deutsch, Paula Dreiblatt, Dolly Nachbar und Benzion Sigall traten in den Künstlerspielen Gäste aus „Ost und West“ auf, besonders beliebt waren die Gastspiele der Siegler-Pastor Truppe aus Rumänien mit ihrem Star Sevilla Pastor. Ernste Theaterkunst boten Paul Baratoff in August Strindbergs „Der Vater“, auch Schauspieler wie Hans Moser traten dort auf.
12 Kiddusch: von hebr. ‚kadosch‘, heilig. Der Begriff findet in verschiedenen Zusammenhängen Verwendung. Als Kiddusch wird u.a. der Segensspruch über einen Becher Wein bezeichnet, der am Schabbat und anderen Festtagen gesagt wird.
13 Pessach: Feiertag am 1. Frühlingsvollmond, zur Erinnerung an die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei, auch als Fest der ungesäuerten Brote [Mazza] bezeichnet.
14 Koscher [hebr.: rein, tauglich]: den jüdischen Speisegesetzen entsprechend.
15 Mazze [hebr.matzá] auch ungesäuertes Brot genannt, ist ein dünner Brotfladen, der von religiösen und traditionsverbundenen Juden während des Pessachfestes gegessen wird. Matze wird aus Wasser und einer der fünf Getreidearten Weizen, Roggen, Gerste, Hafer oder Dinkel ohne Triebmittel gefertigt.
16 Sepharde, Pl. Sepharden [hebr. Sepharad = Iberien]: Juden, deren Vorfahren bis 1492 in Spanien und Portugal ansässig waren. Heute versteht man unter den sephardischen Juden in erster Linie diejenigen Bewohner Israels, die aus Ländern wie Marokko, dem Jemen, Syrien oder Indien nach Israel einwanderten.
17 Aschkenase, Pl. Aschkenasen [hebr. Aschkenas = Deutschland]: die Selbstbenennung der Juden Mittel- und Osteuropas, die eine gemeinsame religiöse Tradition, Kultur und die Jiddische Sprache verbindet
18 Menczer, Aharon [18.04.1917 - 7.10.1943]: Als Mitglied der zionistischen Jugendorganisation Gordonia arbeitete Menczer nach dem Anschluss Österreichs im März 1938 für die Jugend-Alija.
Im März 1939 begleitete er im Auftrag der Organisation eine Gruppe der Jugend-Alija nach Palästina. Aufgrund seines Pflichtgefühls gegenüber der in Wien gebliebenen jüdischen Jugend kehrte er wieder zurück. Auch eine weitere Gelegenheit zur Emigration nahm er nicht wahr.
Im September 1939 wurde Menczer zum Leiter der Jugend-Alija in Wien ernannt. Nachdem 1940 eine Flucht nicht mehr möglich war, konzentrierte er seine Aktivitäten auf die Ausbildung an der Wiener Jugend-Alija-Schule, die regelmäßig von 400 Schülern besucht wurde.
Nachdem die Einrichtungen der Jugend-Alija in Österreich verboten worden waren, wurde Menczer in ein Zwangsarbeiterlager in der Nähe von Linz deportiert. Am 14. September 1942 wurde er nach Wien zurückgebracht und am 24. September nach Theresienstadt überführt. Dort wurde er Jugendführer und im November Mitglied des Hechaluz. Im August 1943 schloss Menczer sich einer Gruppe an, die für 1.260 aus Bialystok gebrachter Kinder sorgte.
Am 15. Oktober desselben Jahres wurde Menczer gemeinsam mit den Kindern nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Am 9. November 2012 wurde vor dem Haus Marc-Aurel-Strasse 5 eine Gedenktafel, dessen Marmorblock aus dem Sinai gebrochen und von Israel nach Wien importiert worden war, in Anwesenheit von Leo Luster, Martin Vogel, Herbert Schwarz, Ari Rath, ‚Kindern’ von Aron Menczer, für Aron Menczer eingeweiht.
19 Kiddusch: von hebr. ‚kadosch‘, heilig. Der Begriff findet in verschiedenen Zusammenhängen Verwendung. Als Kiddusch wird u.a. der Segensspruch über einen Becher Wein bezeichnet, der am Schabbat und anderen Festtagen gesagt wird.
20 Schuschnigg, Kurt [1897 – 1977]: österreichischer christlichsozialer Politiker. Er folgte 1934 dem von Nationalsozialisten ermordeten Dollfuß als Bundeskanzler. Er versuchte, Österreich zum ‚besseren deutschen Staat‘, als es das Deutsche Reich war, zu machen.
Am 9. März 1938 setzte er für den 13. März eine Volksabstimmung über den Erhalt der Eigenstaatlichkeit Österreichs an. Am 11. März 1938 trat er unter dem Druck Nazideutschlands zurück. Nach dem Anschluß wurde Schuschnigg inhaftiert und blieb bis Ende des Zweiten Weltkrieges in Haft. 1948 wanderte er in die USA aus und war bis 1967 Professor für Staatsrecht an der Universität St. Louis/Missouri.
21 Novemberpogrom: Bezeichnung für das [von Goebbels organisierte] ‚spontane‘ deutschlandweite Pogrom der Nacht vom 9. zum 10. November 1938. Im Laufe der ,Kristallnacht’ wurden 91 Juden ermordet, fast alle Synagogen sowie über 7000 jüdische Geschäfte im Deutschen Reich zerstört und geplündert, Juden in ihren Wohnungen überfallen, gedemütigt, verhaftet und ermordet.
22 Minjan [hebr.: Zahl]: Ausdruck für die Anzahl von mindestens zehn erwachsenen männlichen Betern, mit der sich eine Gemeinde konstituiert. Diese Anzahl ist für einen öffentlichen Gemeindegottesdienst notwendig.
23 Edelstein, Jakob [1903-1944] war ein tschechoslovakischer Zionist sowie erster Judenältester im Ghetto Theresienstadt. Nach der Annexion Tschechiens 1939 wurde Edelstein Ansprechpartner der deutschen Besatzer für die Auswanderung tschechischen Juden nach Palästina.
Zwischen 1939 und 1941 reiste er mehrmals ins Ausland und nahm dort Kontakt mit jüdischen Funktionären zwecks Informationsaustausches auf; so reiste er nach Palästina, Triest, Wien, Genua, Berlin, Amsterdam.
Edelstein wurde mit etwa 1000 weiteren jüdischen Männern im Rahmen des sogenannten Nisko-und Lublin-Plans am 18. Oktober 1939 aus Ostrava nach Nisko deportiert. Nach dem Scheitern dieses Plans kehrte Edelstein im November 1939 wieder nach Prag zurück.
Edelsteins Bestreben war zu verhindern, dass die Juden aus dem Protektorat Böhmen und Mähren nach Polen deportiert wurden. Daher schlug er den deutschen Besatzern wiederholt vor, tschechische Juden als Arbeitskräfte im Protektorat einzusetzen. Die Einrichtung des Ghetto Theresienstadt sah Edelstein als Erfolg, da ihm und den anderen jüdischen Funktionären nicht bewusst war, dass Theresienstadt als Durchgangslager für die Vernichtungslager geplant war.
Am 4. Dezember 1941 traf Edelstein mit Familie in Theresienstadt ein. Zeitgleich wurde er erster Judenältester im Ghetto Theresienstadt. Ende Januar 1943 wurde Edelstein als Judenältester von Paul Eppstein abgelöst und wurde nun dessen erster Stellvertreter.
Aufgrund von Unterschieden bei der registrierten und der tatsächlichen Zahl der Insassen des Ghettos wurde er am 9. November 1943 verhaftet und 1943 wurde er in das KZ Auschwitz deportiert. Am 20. Juni 1944 musste Edelstein zunächst der Ermordung seiner Ehefrau Miriam und seines Sohnes Ariel zusehen, bevor er selbst im Krematorium erschossen wurde.
24 Histadrut, die [hebr. Für Zusammenschluss] ist der Dachverband der Gewerkschaften Israels. Sie wurde im Dezember 1920 wurde die Histradut von David Ben Gurion in Haifa gegründet.
25 DP-Lager waren Einrichtungen zur vorübergehenden Unterbringung so genannter ‚Displaced Persons‘ nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland, Österreich und Italien. Als ‚Displaced Persons‘ galten Menschen, die in Folge des Zweiten Weltkriegs aus ihrer Heimat geflohen, verschleppt oder vertrieben worden waren, z. B. Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, Konzentrationslagerhäftlinge und Osteuropäer, die vor der sowjetischen Armee geflüchtet waren.
26 Murmelstein, Benjamin [1905- 1989]: Rabbiner und jüdischer Gelehrter, in Lemberg geboren. Wurde in der NS-Zeit als Leiter der Auswanderungsabteilung der Kultusgemeinde in Wien und 1944 als ‚Judenältester‘ von Theresienstadt eingesetzt. 1945 wurde über Murmelstein in der Tschechoslowakei die Untersuchungshaft verhängt, aber er wurde nicht angeklagt und nach 18 Monaten freigelassen. Bis zu seinem Tod 1989 lebte er als Möbelverkäufer in Rom.
27 NSDAP, die [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei] war eine in der Weimarer Republik entstandene politische Parte, deren Programm beziehungsweise Ideologie von radikalem Antisemitismus und Nationalismus sowie der Ablehnung von Demokratie und Marxismus bestimmt war. Ihr Parteivorsitzender war seit 1921 Adolf Hitler, unter dem sie Deutschland von 1933 bis 1945 als einzige zugelassene Partei beherrschte.
28 NKWD, der [Abkürzung für russisch Narodnyj Komissariat Wnutrennych Del, Volkskommissariat für innere Angelegenheiten«], 1934 gebildetes sowjetisches Unionsministerium, zuständig u. a. für politische Überwachung, Nachrichtendienst, politische Strafjustiz, Verwaltung der Straf- und Verbannungslager [GULAG], war das Instrument des stalinistischen Terrors.
29 Preminger, Otto Ludwig [1905-1986] geboren in Wiznitz, Bukowina, Österreich-Ungarn, war ein österreichisch-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent, Schauspieler, Theaterregisseur, Theaterdirektor, der während des 1. Weltkriegs mit seiner Familie nach Graz zog, Neben seinem Studium der Rechtswissenschaft widmete er sich der Schauspielerei.
1931 drehte Preminger seinen ersten Film, Die große Liebe, der ihn nach seinen erfolgreichen Theaterinszenierungen in Hollywood und New York weiter bekannt machte. Im Oktober 1935 ging er in die USA, drehte dort zahlreiche Kinofilme und wirkte in mehreren Filmen auch als Schauspieler mit.
Er blieb jedoch auch dem Theater treu, bis in die sechziger Jahre arbeitete er als Theaterregisseur in New York. Preminger gehörte zu den vielseitigsten Regisseuren Hollywoods; er drehte Komödien, Kriminalfilme, Western und Literaturverfilmungen.
30 Schukow, Georgi Konstantinowitsch [1896-1974] war Generalstabschef der Roten Armee und Verteidigungsminister und Marschall der Sowjetunion. Schukow wurde als erfolgreicher Verteidiger in der Schlacht um Moskau 1941 und als Sieger der Schlacht um Berlin 1945 international bekannt. In der Nacht auf den 9. Mai 1945 nahm er in Berlin-Karlshort als Vertreter der Sowjetunion die bedingungslose Kapitulation frt deutschen Wehrmacht und aller Teilstreitkräfte entgegen.
31 Peres, Schimon [1923 in Wiszniewo] ist ein israelischer Politiker, Friedensnobelpreisträger und seit 2007 Staatspräsident. Peres ist das weltweit älteste Staatsoberhaupt und war mit Unterbrechungen an mehreren Regierungen beteiligt. Zudem war er mehrmals Vorsitzender der israelischen Arbeitspartei Awoda, aus der er jedoch 2006 austrat.
32 Hitler-Stalinpakt: Als Hitler-Stalin-Pakt bezeichnet man den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt, der am 23. August 1939 in Moskau von dem deutschen Außenminister von Ribbentrop und dem sowjetischen Außenminister Molotow unterzeichnet wurde.
In einem geheimen Zusatzprotokoll legten die Länder die Aufteilung Nordost- und Südeuropas fest, sofern es zu einer ‚territorialen Umgestaltung‘ kommen sollte. Im Zentrum stand die Teilung Polens.
33 Meir, Golda ursprünglich Golda Meyerson, geb. Mabowitsch [geb.1898 in Kiew - 1978 inJerusalem] war eine israelische Politikerin. Sie war von 1956 bis 1965 Außenministerin Israels und von März 1969 bis Juni 1974 die bisher einzige Ministerpräsidentin Israels.
34 Kibbuz [Pl.: Kibbuzim]: landwirtschaftliche Kollektivsiedlung in Palästina, bzw. Israel, die auf genossenschaftlichem Eigentum und gemeinschaftlicher Arbeit beruht.
35 Begin, Menachem [1913 in Brest-Litowsk - 1992 in Tel Aviv] war Ministerpräsident undAußenminister Israels
Nachdem er zunächst aus Polen vor den deutschen Besatzern geflohen war, gelangte er über die Sowjetunion nach Palästina, wo er Führer der Irgun-Untergrundorganisation wurde. Nach der Staatsgründung Israels ging er in die Politik und stieg zum Minister, 1977 schließlich zum israelischen Ministerpräsidenten auf. In seine Amtszeit fiel sowohl der Friedensschluss mit Ägypten, für den er 1978 mit Muhammad Anwar as-Sadat den Friedensnobelpreis erhielt. 1983 trat er als Ministerpräsident aufgrund ausbleibender Erfolge im 1. Libanonkrieg zurück.36 Ben-Gurion, David, gebürtig als David Grün [1886 in Plonsk 1973 in Tel HaSchomer, Israel] war der erste Premierminister Israels und einer der Gründer der sozialdemokratischen Arbeiterpartei Israels. Er war Parteivorsitzender von 1948 bis 1963.
Von 1948 bis 1953 und von 1955 bis 1963 war Ben-Gurion israelischer Premierminister. 1955 amtierte er kurz als Verteidigungsminister
Jabotinsky, Wladimir Zeev [1880 Odessa-1940 Hunter, USA] war ein russischer Zionist und Schriftsteller.
38 Dollfuß, Engelbert [1892-1934]: Österreichischer Christlich-Sozialer Politiker, 1932-1934 Bundeskanzler, schaltete im März 1933 das Parlament aus. 1933 verbot er die NSDAP, die Kommunistische Partei und den Republikanischen Schutzbund, 1934 – nach den Februarkämpfen – auch die Sozialdemokratische Partei.
Er regierte mit Notverordnungen und führte Standrecht und die Todesstrafe ein. 1934 schuf er den autoritären Ständestaat, der sich auf die Kirche, die Heimwehr und die Bauern stützte.
Am 25. Juli 1934 wurde Dollfuß während eines nationalsozialistischen Putschversuches ermordet.
39 Chassid [hebr: ‚der Fromme‘; Pl. Chassidim]: Anhänger des Chassidismus, einer mystisch-religiösen jüdischen Bewegung, die im 18. Jahrhundert in Polen entstand. Neben dem Torastudium rücken im Chassidismus das persönliche oder gemeinschaftliche religiöse Erleben - in Gebet, Liedern und Tänzen - und die ekstatische Begeisterung ins Zentrum.
40 Atatürk geboren als Mustafa Kemal [1881 – 1938] war der Begründer der modernen Republik Türkei und erster Präsident der nach dem 1. Weltkrieg aus dem Osmanischen Reich hervorgegangenen Republik. Er trieb als Machtpolitiker die Modernisierung seines Landes nach westlichem Vorbild beharrlich voran. 1934 verlieh ihm das türkische Parlament den Nachnamens ‚Atatürk’ [Vater der Türken].